digitales
PROGRAMMHEFT
Soko Tatort
Von Nele Stuhler
Depot 2
Uraufführung: 07. Dezember 2023
ca. 1 h 30 Min. • ohne Pause
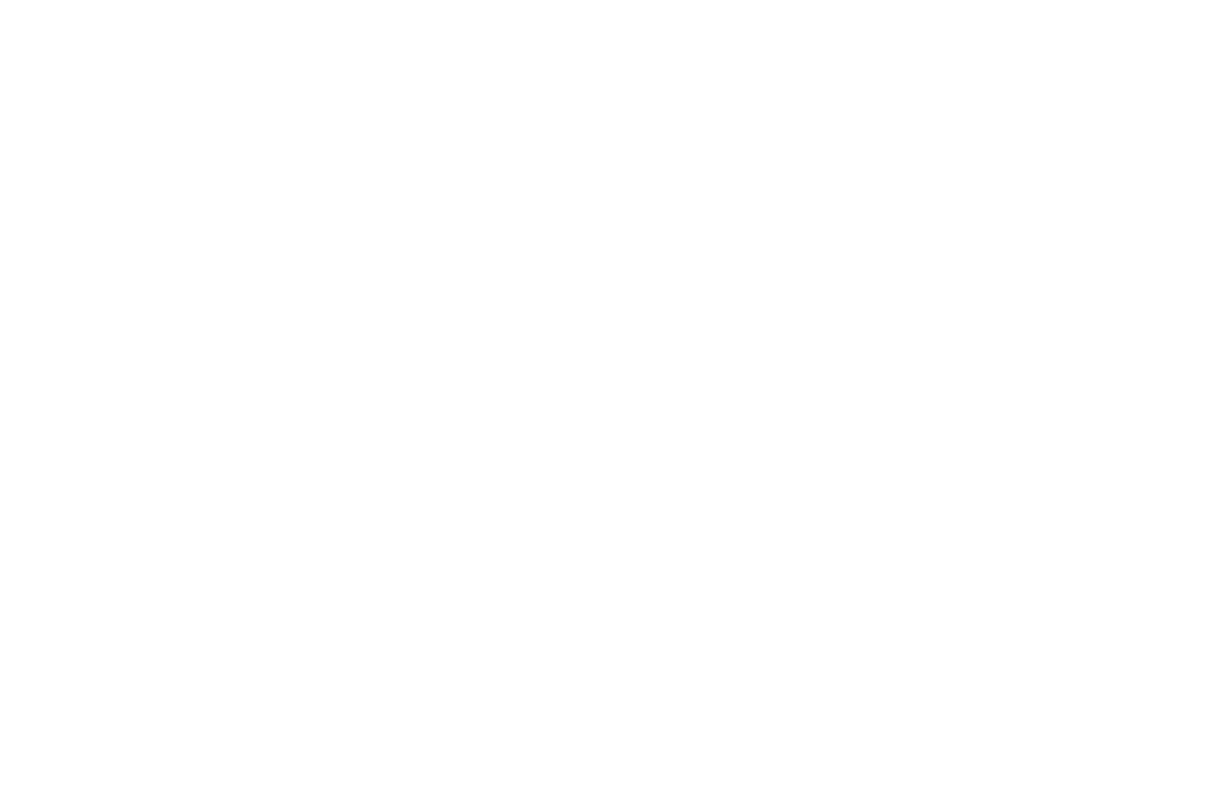
Foto: Thomas Aurin
INHALTSVERZEICHNIS
Team
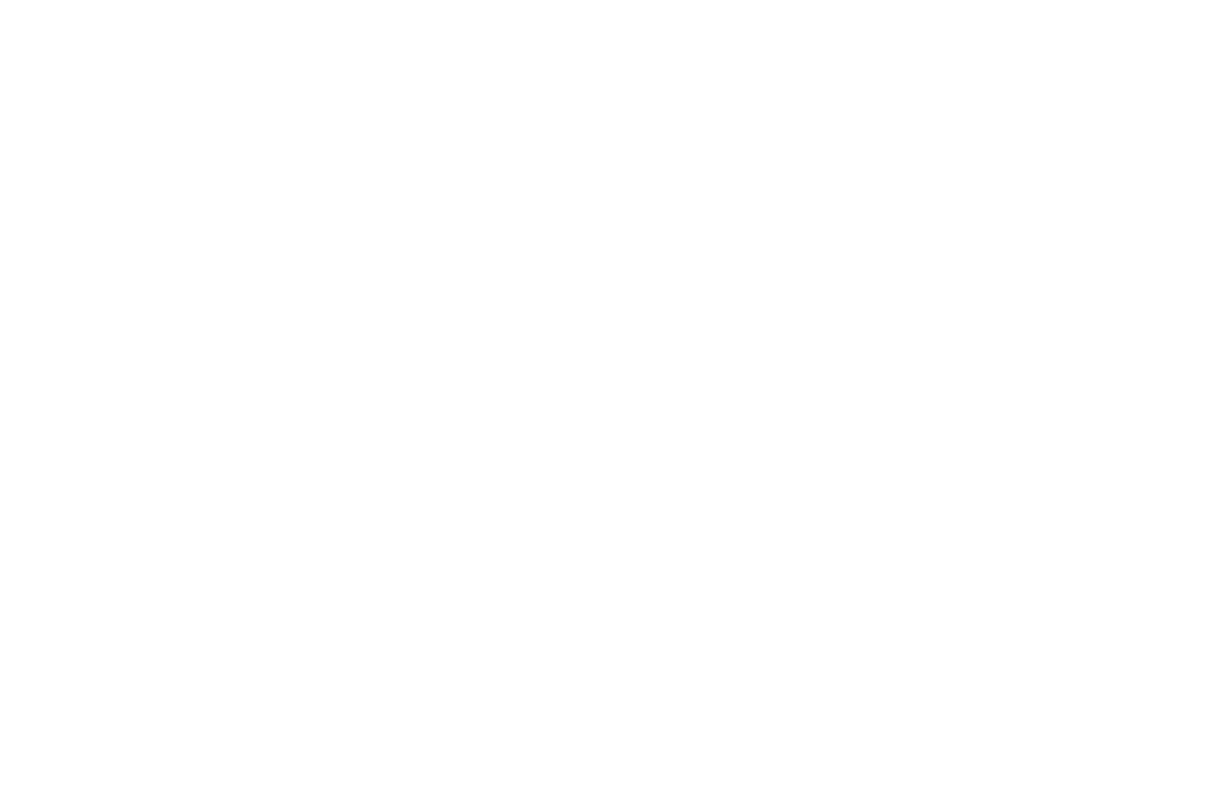
Foto: Thomas Aurin
Text & Regie: Nele Stuhler
Künstlerische Mitarbeit: Lisa Schettel
Bühne: Marilena Büld
Kostüme: Svenja Gassen
Live-Video: Nazgol Emami & Nora Daniels
Musik & Sound: Nils Michael Weishaupt & Max Wutzler
Licht: Jan Steinfatt
Dramaturgie: Jan Stephan Schmieding
REGIEASSISTENZ: Claus Nicolai Six • BÜHNENBILDASSISTENZ: Sarah Pragay • KOSTÜMASSISTENZ: Tegkarn Hanspal • DRAMATURGIEASSISTENZ: Johanna Rummeny • INSPIZIENZ: Charlotte Bischoff • SOUFFLAGE: Victor Herrlich • REGIEHOSPITANZ: Mika Swenshon • BÜHNENBILDHOSPITANZ: Lucia Korbmacher • KOSTÜMHOSPITANZ: Sofia Mielke • BÜHNENTECHNIK: Simon Graf • BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG: Christian Huber & Hagen Ungewitter • TONTECHNIK: Raphael Weiden • VIDEO: Jörg Follert, Viktor Rosengrün & Tom Deutscher • PRODUKTIONSLEITUNG: Oliver Haas, Petra Möhle & Pascal Präckel • STELLVERTR. LTG. WERKSTÄTTEN: Ilya Pfaller • DEKORATIONSAUSFÜHRUNG: Martin Arenz, Florian Hohenkamp, Frank Hohmann, Boris Thelen, Daniel Vogt & Wencke Wesemann • KOSTÜMAUSFÜHRUNG: Maurice Ettl & Elisabeth Huber • SCHUHMACHEREI: Daniela Ehrich & Katrin Mikoleiczik • PUTZMACHEREI: Daphne van der Grinten Chiara Langanke • KOSTÜMMALEREI: Gudrun Fuchs & Marja Adade • ANKLEIDER*INNEN: Philipp Ebert, Sophie Gehrke, Petra Harmuth & Julita Vescovi-Büchel • MASKENBILD: Denise Ecker & Birgit Riedl • REQUISITE / EFFEKTE: Susanne Haaf & Kaja Manenbach / Samar Kraidi
Zum Stück
Ohne Opfer geht es nicht los – zumindest im Krimi. So auch bei SOKO TATORT: Während der Proben zu einem neuen Kriminal-Stück wird ein Mitglied der Theatergruppe »Ermessens-Spielraum« auf offener Szene ermordet. Wilhelm Wilme, Kriminalkommissar a.D., stirbt, und das just in dem Moment, in dem auch im Stück der Mord geschieht. Doch wer hatte ein Interesse an Wilmes Ableben? Wie viele Verdächtige braucht es für einen guten Krimi, damit gerade so viel Spannung aufkommt, dass die geltende Ordnung rechtzeitig nach 90 Minuten wiederhergestellt ist und alle ruhig schlafen können? Ein prominent besetztes Team von Ermittler*innen mit reichlich Dreherfahrung nimmt die Fährte auf, um Licht ins Dunkel des beliebtesten aller Fernseh-Genres zu bringen. Bei der Spurensuche stolpern sie über Ungereimtheiten auf den verschiedensten Realitäts-Ebenen – um schließlich bei grundlegenden Fragen zu landen: Wie stehen wir zur Polizei, warum muss Strafe sein, und wer sagt das eigentlich?
Mit ihrer neuen Krimi-Komödie SOKO TATORT untersucht die Berliner Autorin und Regisseurin Nele Stuhler mit ihrem Ensemble Hell- und Dunkelfelder des Verbrechens und seiner Aufklärung zwischen TV-Realität und polizeilicher Wirklichkeit.
Mit ihrer neuen Krimi-Komödie SOKO TATORT untersucht die Berliner Autorin und Regisseurin Nele Stuhler mit ihrem Ensemble Hell- und Dunkelfelder des Verbrechens und seiner Aufklärung zwischen TV-Realität und polizeilicher Wirklichkeit.
Über Nele Stuhler
Nele Stuhler, Autorin, Regisseurin und Performerin, wurde im Jugendclub p14 der Volksbühne, in der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen und im Studiengang Szenisches Schreiben von uniT in Graz theatral sozialisiert. Sie schreibt in den unterschiedlichsten Konstellationen, alleine oder im Team, wobei ihre Texte häufig in enger Zusammenarbeit mit dem Ensemble während des Probenprozesses entstehen.
2011 gründete Nele Stuhler mit Falk Rößler und Stephan Dorn das Theaterkollektiv FUX, das nach neuen theatralen Formaten über die Befragung bestehender Bühnenformate sucht und mit denen sie bereits zahlreiche Projekte realisierte, unter anderem 2015 LANGER ATEM am Großen Haus des Stadttheaters Gießen, 2016 FUX GEWINNT an den Münchner Kammerspielen, der Kaserne Basel, am Mousonturm Frankfurt und am Theaterdiscounter in Berlin. 2019 entstand im in einer Kooperation WAS IHR WOLLT – DER FILM am Schauspielhaus Wien und wurde zu den Autor*innentheatertagen 2020 eingeladen. 2020 entwickelte FUX am Theater Oberhausen die Mockumentary FROM HORROR TILL OBERHAUSEN, die 2021 Teil der FAUST-Retrospektive für innovative Projekte und Produktionen war, die während der Corona Pandemie entstanden.
Eine enge Zusammenarbeit verbindet sie zudem mit Jan Koslowski, mit dem sie als LAIEN DES ALLTAGS und als STUHLER / KOSLOWSKI arbeitet, unter anderem am Schauspiel Frankfurt, am Schauspiel Graz und am Ballhaus Ost in Berlin.
Am Schauspiel Köln inszeniert sie 2023/24 die eigene Uraufführung SOKO TATORT.
2011 gründete Nele Stuhler mit Falk Rößler und Stephan Dorn das Theaterkollektiv FUX, das nach neuen theatralen Formaten über die Befragung bestehender Bühnenformate sucht und mit denen sie bereits zahlreiche Projekte realisierte, unter anderem 2015 LANGER ATEM am Großen Haus des Stadttheaters Gießen, 2016 FUX GEWINNT an den Münchner Kammerspielen, der Kaserne Basel, am Mousonturm Frankfurt und am Theaterdiscounter in Berlin. 2019 entstand im in einer Kooperation WAS IHR WOLLT – DER FILM am Schauspielhaus Wien und wurde zu den Autor*innentheatertagen 2020 eingeladen. 2020 entwickelte FUX am Theater Oberhausen die Mockumentary FROM HORROR TILL OBERHAUSEN, die 2021 Teil der FAUST-Retrospektive für innovative Projekte und Produktionen war, die während der Corona Pandemie entstanden.
Eine enge Zusammenarbeit verbindet sie zudem mit Jan Koslowski, mit dem sie als LAIEN DES ALLTAGS und als STUHLER / KOSLOWSKI arbeitet, unter anderem am Schauspiel Frankfurt, am Schauspiel Graz und am Ballhaus Ost in Berlin.
Am Schauspiel Köln inszeniert sie 2023/24 die eigene Uraufführung SOKO TATORT.
»Länderspiegel mit Leichen« – eine kleine Soziologie des Tatorts
Die Erfindung des Tatorts hätte wohl selbst das Zeug dazu gehabt, eine Szene aus einem Krimi zu werden. Der riesige Erfolg der Krimiserie DER KOMMISSAR von Konkurrenzsender ZDF war 1969 der Auslöser für ein skurriles Krisengespräch dreier WDR-Programmverantwortlicher, von dem der ehemalige ARD-Tatort-Koordinator Gebhard Henke berichtet und, ganz in der Tradition seines Genres, genüsslich zuspitzt: »Drei Männer in beigen Trenchcoats beim Spaziergang um den Aachener Weiher, Sorgenfalten auf den Gesichtern, angestrengtes Nachdenken, Ratlosigkeit, bis ein leises »Ich glaub, ich hab‘s« aus dem Munde von WDR-Fernsehspiel-Redakteur Gunther Witte die angespannte Stille durchbricht. Der Tatort war geboren.«[1]
Was folgte, ist vielleicht die größte Erfolgsgeschichte des deutschen Fernsehens überhaupt. Die Reihe geht derweil ins 54. Jahr, es wurden bereits mehr als 1250 Folgen produziert, die von durchschnittlich 8,1 Millionen Menschen, in der Spitze gar bis zu 14 Millionen, angeschaut werden. Was macht den Erfolg dieses Formats aus, und wie funktioniert ein solcher Polizeifilm?
Die US-Fernsehjournalisten Horace Newcomb und Paul M. Hirsch haben das Fernsehen einmal als »Bühne des Nicht-Normalen« beschrieben, die die Verständigung über die eigenen Normen und Wertvorstellungen erleichtert.[2] Der Tatort ist dafür ein gutes Beispiel. In seiner föderalistischen Struktur (jede der neun ARD-Rundfunkanstalten, dazu SRF und ORF, produziert eigene Folgen) gilt der Tatort längst als »Länderspiegel mit Leichen«.[3] Er bildet Woche für Woche bundesdeutsche Realität(en) ab und baut so seit fünf Jahrzehnten ein Archiv unserer Kultur- und Zeitgeschichte auf.
Die Struktur des Krimis eignet sich dafür wie kaum ein anderes Genre. Mit jeder neuen Tatort-Folge kann ein anderes Milieu gewählt werden, in dem ein Mord, die für den Krimi notwendige Normabweichung, auf persönliche, soziale, wirtschaftliche oder gesellschaftspolitische Zusammenhänge zurückgeführt und näher beleuchtet werden kann. Täter*innen und ihre Opfer werden so zu Repräsentant*innen von gesellschaftlichen (Fehl-)Entwicklungen. Die Verhältnisse, nicht etwa die Menschen sind, wie es schon bei Brecht heißt, für das Böse verantwortlich und werden im Krimi zur »Meta-Täterin«[4]. Die so dargestellte »Wirklichkeit« wird aus dem Blickwinkel der Ermittelnden wahrgenommen, diskutiert und nicht selten moralisch bewertet; ein Blickwinkel, der die Sympathielenkung des Fernsehpublikums maßgeblich beeinflusst. Die Themenpalette ist riesig und reicht von Skandalen in der Bau- und Pharmawirtschaft, Pflegenotstand und Lohnungerechtigkeit über Terror von Rechts bis hin zu #Metoo-Fällen. Teilweise dienen dabei echte Ereignisse als Vorbilder für die Filmplots. Die Ermittelnden tauschen sich im Verlauf der Handlung über das Milieu und seine Verhältnisse aus, treffen während der Spurensuche auf Expert*innen, die für sie komplexe Zusammenhänge in verdauliche Portionen herunterbrechen. All das trägt dazu bei, filmische »Realität« zu konstruieren. Beschwerden von Berufsverbänden, die nach der Ausstrahlung einer neuen Folge monieren, dass der Film ein verzerrtes Bild der eigenen Branche gezeichnet habe, gehören zum Tatort ebenso wie die garantierte Aufklärung des Falles nach 90 Minuten.
Zum filmisch erzeugten Realismus des Tatorts gehören auch die wiederkehrende Inszenierung von architektonischen Wahrzeichen der jeweiligen Stadt, die Verwendung von Dialekt und die Bezugnahme auf Spezialitäten von Brauchtum und sozialen Milieus – von der Currywurstbude vor dem Kölner Dom bis hin zu Motto-Tatorten auf der Wies’n, unter württembergischen Weinköniginnen oder in der Hamburger Hafencity. Indem sie Elemente von Thriller, Sozialdrama, Heimatfilm oder Komödie integrieren, werden die Polizei-Filme des Tatorts auch immer zu Genre-Hybriden. Dabei pendelt der Krimi unablässig zwischen den Polen Unterhaltung und Information, Faktualität und Fiktion, Ernst und Unernst.
Die außerfilmische Realität wird im Krimi, nicht nur aus dramaturgisch-erzählerischen Gründen, noch in vielen weiteren Bereichen nicht abgebildet. Etwa in der im Vergleich zu den realen Verhältnissen deutlich höheren Frauen-Quote in den Tatort-Teams, der fast hundertprozentigen Aufklärungsquote und der Häufung von Tötungsdelikten im Film, die weder in Münster, Kiel, Bremen noch in Ludwigshafen und Konstanz auch nur ansatzweise der Realität entsprechen.[5] Das Geschlecht der Film-Täter*innen könnte nahezu der deutschen Kriminalstatistik entnommen worden sein; im Tatort werden rund 80 Prozent der Morde von Männern begangen. Die tatsächliche Quote liegt sogar noch etwas höher. Dagegen werden Frauen im Tatort seltener das Opfer als das tatsächlich der Fall ist (25% gegenüber nahezu 50% in Wirklichkeit).
Auch was die Berufsgruppen der Täter*innen angeht, hat der Tatort eine besonders kriminelle Gruppe ausgemacht. In rund zehn Prozent der Fälle, bis einschließlich 2018 ganze 109 Mal, verübten Unternehmer oder Managerinnen den Mord; noch häufiger als die Gruppe von »Berufskriminellen«, die nur auf 100 Fälle kommt.[6] Der Tatort fokussiert gerne und häufig auf die Fehlentwicklungen des Kapitalismus, wählt Habgier als Motiv und wird so zur systemkritischen Instanz.
Die ermittelnden Beamt*innen selbst vertreten im Tatort in der Regel moralisch akzeptierte Positionen, auch wenn sie zum Teil selbst heftig von den Widrigkeiten des Lebens gebeutelt sind und mitunter gegen soziale Normen verstoßen, zum Beispiel durch Alkoholismus oder soziale Verwahrlosung. Stärkere Normverstöße wie Selbstjustiz sind äußerst selten und rufen meist heftige Proteste hervor, etwa nach der Kölner Folge BESTIENvon 2001, in dem die beiden Kommissare aus Betroffenheit mit den Vorgängen Beweismaterial verschwinden lassen.[7] Üblicherweise zeigen sich Fernseh-Kommissar*innen empathisch gegenüber Randgruppen, versichern sich im Gespräch gegenseitig ihrer Werte und ihrer politischen Korrektheit. Zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen taugen sie eher nicht, sondern werden vielmehr häufig gegenüber den Verhältnissen als machtlos gezeichnet.
Als gut geölte »Konsensmaschine«[8] leistet der Tatort, gerade durch die auf die Gesetzeshüter*innen fokussierte Erzählperspektive, systemstabilisierendes Politainment. Nach 90 Minuten sind Fall und Polizei gleichermaßen aufgeklärt, und, ganz nebenbei, das Fernsehpublikum gleich mit. Über die Phänomene des Strafens, der Resozialisierung, den Tod und den Opferschutz vermag das Genre bislang eher wenig zu erzählen. Aber dergleichen ließe die Zuschauer*innen möglicherweise auch schlechter schlafen.
Jan Stephan Schmieding
Was folgte, ist vielleicht die größte Erfolgsgeschichte des deutschen Fernsehens überhaupt. Die Reihe geht derweil ins 54. Jahr, es wurden bereits mehr als 1250 Folgen produziert, die von durchschnittlich 8,1 Millionen Menschen, in der Spitze gar bis zu 14 Millionen, angeschaut werden. Was macht den Erfolg dieses Formats aus, und wie funktioniert ein solcher Polizeifilm?
Die US-Fernsehjournalisten Horace Newcomb und Paul M. Hirsch haben das Fernsehen einmal als »Bühne des Nicht-Normalen« beschrieben, die die Verständigung über die eigenen Normen und Wertvorstellungen erleichtert.[2] Der Tatort ist dafür ein gutes Beispiel. In seiner föderalistischen Struktur (jede der neun ARD-Rundfunkanstalten, dazu SRF und ORF, produziert eigene Folgen) gilt der Tatort längst als »Länderspiegel mit Leichen«.[3] Er bildet Woche für Woche bundesdeutsche Realität(en) ab und baut so seit fünf Jahrzehnten ein Archiv unserer Kultur- und Zeitgeschichte auf.
Die Struktur des Krimis eignet sich dafür wie kaum ein anderes Genre. Mit jeder neuen Tatort-Folge kann ein anderes Milieu gewählt werden, in dem ein Mord, die für den Krimi notwendige Normabweichung, auf persönliche, soziale, wirtschaftliche oder gesellschaftspolitische Zusammenhänge zurückgeführt und näher beleuchtet werden kann. Täter*innen und ihre Opfer werden so zu Repräsentant*innen von gesellschaftlichen (Fehl-)Entwicklungen. Die Verhältnisse, nicht etwa die Menschen sind, wie es schon bei Brecht heißt, für das Böse verantwortlich und werden im Krimi zur »Meta-Täterin«[4]. Die so dargestellte »Wirklichkeit« wird aus dem Blickwinkel der Ermittelnden wahrgenommen, diskutiert und nicht selten moralisch bewertet; ein Blickwinkel, der die Sympathielenkung des Fernsehpublikums maßgeblich beeinflusst. Die Themenpalette ist riesig und reicht von Skandalen in der Bau- und Pharmawirtschaft, Pflegenotstand und Lohnungerechtigkeit über Terror von Rechts bis hin zu #Metoo-Fällen. Teilweise dienen dabei echte Ereignisse als Vorbilder für die Filmplots. Die Ermittelnden tauschen sich im Verlauf der Handlung über das Milieu und seine Verhältnisse aus, treffen während der Spurensuche auf Expert*innen, die für sie komplexe Zusammenhänge in verdauliche Portionen herunterbrechen. All das trägt dazu bei, filmische »Realität« zu konstruieren. Beschwerden von Berufsverbänden, die nach der Ausstrahlung einer neuen Folge monieren, dass der Film ein verzerrtes Bild der eigenen Branche gezeichnet habe, gehören zum Tatort ebenso wie die garantierte Aufklärung des Falles nach 90 Minuten.
Zum filmisch erzeugten Realismus des Tatorts gehören auch die wiederkehrende Inszenierung von architektonischen Wahrzeichen der jeweiligen Stadt, die Verwendung von Dialekt und die Bezugnahme auf Spezialitäten von Brauchtum und sozialen Milieus – von der Currywurstbude vor dem Kölner Dom bis hin zu Motto-Tatorten auf der Wies’n, unter württembergischen Weinköniginnen oder in der Hamburger Hafencity. Indem sie Elemente von Thriller, Sozialdrama, Heimatfilm oder Komödie integrieren, werden die Polizei-Filme des Tatorts auch immer zu Genre-Hybriden. Dabei pendelt der Krimi unablässig zwischen den Polen Unterhaltung und Information, Faktualität und Fiktion, Ernst und Unernst.
Die außerfilmische Realität wird im Krimi, nicht nur aus dramaturgisch-erzählerischen Gründen, noch in vielen weiteren Bereichen nicht abgebildet. Etwa in der im Vergleich zu den realen Verhältnissen deutlich höheren Frauen-Quote in den Tatort-Teams, der fast hundertprozentigen Aufklärungsquote und der Häufung von Tötungsdelikten im Film, die weder in Münster, Kiel, Bremen noch in Ludwigshafen und Konstanz auch nur ansatzweise der Realität entsprechen.[5] Das Geschlecht der Film-Täter*innen könnte nahezu der deutschen Kriminalstatistik entnommen worden sein; im Tatort werden rund 80 Prozent der Morde von Männern begangen. Die tatsächliche Quote liegt sogar noch etwas höher. Dagegen werden Frauen im Tatort seltener das Opfer als das tatsächlich der Fall ist (25% gegenüber nahezu 50% in Wirklichkeit).
Auch was die Berufsgruppen der Täter*innen angeht, hat der Tatort eine besonders kriminelle Gruppe ausgemacht. In rund zehn Prozent der Fälle, bis einschließlich 2018 ganze 109 Mal, verübten Unternehmer oder Managerinnen den Mord; noch häufiger als die Gruppe von »Berufskriminellen«, die nur auf 100 Fälle kommt.[6] Der Tatort fokussiert gerne und häufig auf die Fehlentwicklungen des Kapitalismus, wählt Habgier als Motiv und wird so zur systemkritischen Instanz.
Die ermittelnden Beamt*innen selbst vertreten im Tatort in der Regel moralisch akzeptierte Positionen, auch wenn sie zum Teil selbst heftig von den Widrigkeiten des Lebens gebeutelt sind und mitunter gegen soziale Normen verstoßen, zum Beispiel durch Alkoholismus oder soziale Verwahrlosung. Stärkere Normverstöße wie Selbstjustiz sind äußerst selten und rufen meist heftige Proteste hervor, etwa nach der Kölner Folge BESTIENvon 2001, in dem die beiden Kommissare aus Betroffenheit mit den Vorgängen Beweismaterial verschwinden lassen.[7] Üblicherweise zeigen sich Fernseh-Kommissar*innen empathisch gegenüber Randgruppen, versichern sich im Gespräch gegenseitig ihrer Werte und ihrer politischen Korrektheit. Zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen taugen sie eher nicht, sondern werden vielmehr häufig gegenüber den Verhältnissen als machtlos gezeichnet.
Als gut geölte »Konsensmaschine«[8] leistet der Tatort, gerade durch die auf die Gesetzeshüter*innen fokussierte Erzählperspektive, systemstabilisierendes Politainment. Nach 90 Minuten sind Fall und Polizei gleichermaßen aufgeklärt, und, ganz nebenbei, das Fernsehpublikum gleich mit. Über die Phänomene des Strafens, der Resozialisierung, den Tod und den Opferschutz vermag das Genre bislang eher wenig zu erzählen. Aber dergleichen ließe die Zuschauer*innen möglicherweise auch schlechter schlafen.
Jan Stephan Schmieding
[1] Im Hintergrundgespräch über die Reihe im September 2023.
[2] Zitiert nach: Bleicher, Joan Kristin: Der Tatort als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen am Beispiel der Veränderung von Täterprofilen, in: Christian Hißnauer, Stefan Scherer, Claudia Stockinger (ed.): Zwischen Serie und Werk. Fernseh- und Gesellschaftsgeschichte im »Tatort«, 2014, S. 105.
[3] Bertram Eisenhauer: Tatort Deutschland. Sozialgeschichte und Mentalitäten im Spiegel des Kriminalfilms. In: Claudia Cippitelli / Axel Schwanebeck (Hg.): Das Mord(s)programm. Krimis und Action im deutschen Fernsehen. Frankfurt/M.: Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik 1998, S. 63–87, hier S. 65.
[4] Vgl. Georg Seeßlen, Whodunit (Wer hat es getan?). Über das Kriminalgenre, http://www.getidan.de/kolumne/georg_seesslen/1115/whodunit-wer-hat-es-getan, zuletzt aufgerufen am 27.11.23)
[5]Vgl. https://www.rnd.de/medien/datenanalyse-der-tatort-stellt-die-mordstatistik-auf-den-kopf-5QSOGMC5N5C2LHKUVCM42U5PAQ.html (zuletzt aufgerufen am 27.11.23)
[6] Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/715288/umfrage/moerder-in-den-tatort-krimis-nach-berufsgruppen/ (zuletzt aufgerufen am 27.11.23)
[7] Im genannten Fall soll sogar der damals amtierende Bundeskanzler, Gerhard Schröder, zu Protokoll gegeben haben, dass die Folge zwar ein guter Krimi gewesen sei, nun aber nicht gerade den Glauben an den Rechtsstaat fördere.
[8] Zitiert nach: Buhl, Hendrik: Tatort, Gesellschaftspolitische Themen in der Krimireihe, 2013, S. 304.
[2] Zitiert nach: Bleicher, Joan Kristin: Der Tatort als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen am Beispiel der Veränderung von Täterprofilen, in: Christian Hißnauer, Stefan Scherer, Claudia Stockinger (ed.): Zwischen Serie und Werk. Fernseh- und Gesellschaftsgeschichte im »Tatort«, 2014, S. 105.
[3] Bertram Eisenhauer: Tatort Deutschland. Sozialgeschichte und Mentalitäten im Spiegel des Kriminalfilms. In: Claudia Cippitelli / Axel Schwanebeck (Hg.): Das Mord(s)programm. Krimis und Action im deutschen Fernsehen. Frankfurt/M.: Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik 1998, S. 63–87, hier S. 65.
[4] Vgl. Georg Seeßlen, Whodunit (Wer hat es getan?). Über das Kriminalgenre, http://www.getidan.de/kolumne/georg_seesslen/1115/whodunit-wer-hat-es-getan, zuletzt aufgerufen am 27.11.23)
[5]Vgl. https://www.rnd.de/medien/datenanalyse-der-tatort-stellt-die-mordstatistik-auf-den-kopf-5QSOGMC5N5C2LHKUVCM42U5PAQ.html (zuletzt aufgerufen am 27.11.23)
[6] Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/715288/umfrage/moerder-in-den-tatort-krimis-nach-berufsgruppen/ (zuletzt aufgerufen am 27.11.23)
[7] Im genannten Fall soll sogar der damals amtierende Bundeskanzler, Gerhard Schröder, zu Protokoll gegeben haben, dass die Folge zwar ein guter Krimi gewesen sei, nun aber nicht gerade den Glauben an den Rechtsstaat fördere.
[8] Zitiert nach: Buhl, Hendrik: Tatort, Gesellschaftspolitische Themen in der Krimireihe, 2013, S. 304.
Quellen
Bleicher, Joan Kristin: Der Tatort als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen am Beispiel der Veränderung von Täterprofilen, in: Christian Hißnauer, Stefan Scherer, Claudia Stockinger (ed.): Zwischen Serie und Werk. Fernseh- und Gesellschaftsgeschichte im »Tatort«, 2014.
Buhl, Hendrik: Tatort, Gesellschaftspolitische Themen in der Krimireihe, 2013.
Heinze, Carsten: Alltagskonstruktionen und soziale Rolle. Eine soziologische Perspektive auf den Tatort, in: Christian Hißnauer, Stefan Scherer, Claudia Stockinger (ed.): Zwischen Serie und Werk. Fernseh- und Gesellschaftsgeschichte im »Tatort«, 2014.
Seeßlen, Georg, Whodunit (Wer hat es getan?). Über das Kriminalgenre, http://www.getidan.de/kolumne/georg_seesslen/1115/whodunit-wer-hat-es-getan, zuletzt aufgerufen am 27.11.23).
Buhl, Hendrik: Tatort, Gesellschaftspolitische Themen in der Krimireihe, 2013.
Heinze, Carsten: Alltagskonstruktionen und soziale Rolle. Eine soziologische Perspektive auf den Tatort, in: Christian Hißnauer, Stefan Scherer, Claudia Stockinger (ed.): Zwischen Serie und Werk. Fernseh- und Gesellschaftsgeschichte im »Tatort«, 2014.
Seeßlen, Georg, Whodunit (Wer hat es getan?). Über das Kriminalgenre, http://www.getidan.de/kolumne/georg_seesslen/1115/whodunit-wer-hat-es-getan, zuletzt aufgerufen am 27.11.23).
Die Normalisierung der Ungleichheit
Ein polizeikritisches Interview mit der Kriminologin Friederike Häuser. Sie arbeitet und promoviert im Themenbereich Radikalisierung. Nebenbei arbeitet und veröffentlicht sie zu den Schwerpunkten Straf- und Kontrollpraktiken, kritische Stadtforschung, Polizei und Graffiti.
SOKO TATORT nimmt das Erscheinungsbild in den Blick, das die Flut an Krimisendungen im deutschen Fernsehen von der Polizei erzeugt. Wie geht es Ihnen als Kriminologin, wenn Sie einen Polizei-Film anschauen?
Ich finde es auffällig, dass der Fokus immer so darauf liegt zu zeigen, wie menschlich die Ermittelnden sind und dass die Zuschauenden Sympathie mit den Polizist*innen bekommen sollen. Es geht selten um die komplexen gesellschaftspolitischen Dimensionen von Kriminalität und den Umgang damit, sondern wir sollen unterm Strich nur sehen, dass die Beamt*innen auch nur Menschen sind, dass die es auch schwer haben, Probleme haben und so weiter. Diskurstheoretisch sind wir dann auf der Ebene, auf die auch von Polizeikampagnen abgezielt wird: Man soll grundsätzlich Respekt vor der Polizei haben, Verständnis dafür, dass ihr Job nicht leicht ist. Ich finde aber Respekt müssen sie sich erstmal verdienen und da reicht es nicht, drauf aufmerksam zu machen, dass sie Menschen sind. Polizist*innen sind ja nicht wie du und ich. Die haben eine ganz andere Wirkungsmacht und üben ein Gewaltmonopol aus. Also ich kann die klassischen Krimis nicht genießen, weil sie mir zu unkritisch sind und das produzierte Bild zu sehr die Perspektive der Institution vertritt.
Für Ihre Masterarbeit hatten Sie Gelegenheit, empirische Forschung bei Einsätzen der Polizei zu betreiben. Wie würden Sie nach diesen Erfahrungen den Zustand der Polizei und ihr Selbstbild beschreiben?
Meiner Erfahrung nach ist die Polizei in einem extrem kritischen Zustand, aber ihr Selbstbild ist gleichzeitig selbstbewusster denn je. Sie erfährt viel Kritik, aber statt darauf einzugehen, labelt sie Kritiker*innen als respektlose Gegner. Daraus resultiert dann eine »Wir versus ihr« Dynamik, aus der heraus sie nichts lernt, sondern alles immer schlimmer wird. Statt Fehlerkulturen zu etablieren, kreiert sie eine Dichotomie, die in einem kriegsähnlichen Zustand mündet. Deshalb wurde bei dem Einsatz von Bodycams auch von »Waffengleichheit« gesprochen. Vorher hatten die Bürger*innen ja immer die Möglichkeit, Einsätze mit ihren Handys zu filmen, und nun kann die Polizei endlich die Waffe namens »Bild« dagegen halten. Während meiner Forschung habe ich öfter erlebt, dass die Bodycam als solch ein Mittel zur Gerechtigkeit geframed wurde. Und das bedeutet ja, dass die gefühlte Ungerechtigkeit darin bestand, dass ganz normale Bürger*innen die polizeiliche Arbeit kritisch beobachten und dokumentieren konnten. Da sieht man wieder, was für die Institution eine Gefahr bedeutet. Gleichzeitig habe ich als Forscherin erlebt, wie übermäßig selbstsicher die Beamt*innen waren. Die waren sich einfach sicher, dass sie – obwohl ich als externe Beobachterin anwesend war – illegitime Gewalt anwenden, in allen Formen diskriminierende Sprache verwenden und Dienstanweisungen geben können, mit denen sie aktiv die tatsächliche Situation im Einsatzgebiet beeinflussen und die Darstellung der Realität dadurch verzerren. Ich glaube, es ist einfach auch selten, dass Menschen, wenn sie in so krassen Machtpositionen sind, diese nicht auch ausnutzen. Meiner Erfahrung nach fühlt sich die Polizei darin zu sicher.
In Ihrer Forschung haben Sie unter anderem die sich schnell verbreitende Verwendung von Bodycams bei Polizeieinsätzen kritisch unter die Lupe genommen. Können Sie ein bisschen über die Gründe für den Einsatz dieses Instrumentes berichten, nach welchen Prinzipien es eingesetzt wird und wie sich die Nutzung auf den Polizeidienst auswirkt?
Die Polizei nutzt in der Öffentlichkeit schon lange die Erzählung, dass die Übergriffe gegen sie häufiger werden und sie deshalb eine bessere Ausstattung brauchen. Es gibt für den Anstieg dieser Übergriffe keine empirischen Belege, bzw. können diese auch leicht von der Polizei selbst kreiert werden. Öffentlich und politisch sollen Empathie und Sympathie dahin gelenkt werden, dass die Polizei ja alles für unsere Sicherheit tut und deshalb auch alles an Schutz verdient hat. An der Stelle muss man noch mal sagen, dass die Polizei nicht dafür da ist, Kriminalität zu verhindern, sondern lediglich auf sie zu reagieren. Und für sehr viele Menschen ist die Polizei überhaupt kein Schutz, sondern eher eine Gefahr. Oft entsteht Kriminalität auch überhaupt erst durch die Präsenz der Polizei. Naja, aber die Bodycams wurden im Rahmen dieser Heldenerzählung als nötig befunden und durchgesetzt, meist still und heimlich. Allein dieser Fakt ist einer von vielen Belegen für die Definitionsmacht der Polizei. Sie sagen einfach »das ist nötig« und dann ist es so. Und mit der Bodycam wird ebendiese Definitionsmacht noch verstärkt. Denn die Beamt*innen entscheiden nicht nur, wann bzw. ob die Kamera eingeschaltet wird, sondern sie bestimmen dann ja auch, was gefilmt wird, welche Bilder man sieht. Weil die Kameras wie der Name schon sagt am Körper befestigt sind, kommt es im Prinzip auf die genaue Körperhaltung der Filmenden an und wie sie als Kameraleute fähig sind, eine komplexe Situation zu dokumentieren. In der Anleitung zur Nutzung der Bodycam hieß es »Ihr müsst denken wie ein Regisseur«. Daran sieht man deutlich, in wessen Perspektive, Sichtweise und Motivation es liegt, welche Bilder produziert werden. Und am Ende auch, welche Bilder gespeichert werden und welche nicht. Das Bild fungiert als Waffe und die Beamt*innen als Regisseur*innen. Die Bilder, die nicht produziert werden, sind entsprechend auch von Bedeutung, aber nicht nützlich im Interesse der Produzent*innen.
In der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Polizei gibt es den Begriff »Cop Culture« – was verbirgt sich dahinter und welche Mechanismen, beziehungsweise Automatismen gehören dazu?
Cop Culture ist im Prinzip alles, was innerhalb der Institution stattfindet, also alle Gepflogenheiten, Dynamiken – alles, was man eben nur richtig mitkriegt, wenn man drinsteckt. Diese Unternehmenskultur ist also nicht das, was die Polizei nach außen richtet, sondern was Informelles. Der Polizeiwissenschaftler Rafael Behr hat über diesen Begriff geschrieben und deutlich gemacht, dass Cop Culture geprägt ist von z.B. Männlichkeit und Gewalt. Er benennt auch die Kombination dieser Aspekte als die »Krieger-Männlichkeit«, die geprägt ist von dem Willen sich auch körperlich gegen ein Gegenüber durchzusetzen. Das Polizeiliche Gegenüber ist selten auf Augenhöhe, sondern es wird oft bei jeder Gelegenheit das Machtgefälle deutlich gemacht und dass man eben nicht auf einer Seite steht. Umso enger zusammengeschweißt ist man dann untereinander. Das funktioniert wie in subkulturellen Zusammenschlüssen, dass eine Form von Loyalität und Zusammenhalt identitätsstiftend sein kann. Daraus können dann Mechanismen entstehen, etwa dass man sich gegenseitig schützt, wenn Vorwürfe von außen kommen. Normal wird durch diese Kultur ein Automatismus, dass man, was innerhalb der Mauern passiert auch da drin lässt. Und das manifestiert das »wir versus ihr« natürlich noch mehr. Innerhalb dieser Dichotomie-Dynamik und einer mauernden Cop Culture ist es schwierig, anders zu sein.
Die Parole ACAB, also »All Cops are Bastards«, meint genau das: Du kannst vielleicht ein guter Mensch sein, aber sobald du dich in das Polizeisystem begibst und Teil dieser Kultur wirst, dann kannst du kein guter Mensch bleiben. In meiner Forschung hatte ich zum Beispiel den Fall, dass eine Polizistin meinte, sie habe am Anfang sich noch gestört an dem täglichen Sexismus ihr gegenüber und auch was dagegen gesagt. Aber dann wurde sie dafür abgestraft, dass sie das kritisiert hatte – sie wurde ausgeschlossen und gemobbt. Also ist die Lösung, dass sie jetzt wieder mitlacht bei sexistischen Witzen, um in der Institution und im Polizeialltag zu überleben. Wer kein Teil der Cop Culture ist, dem wird es so schwer gemacht, dass es eigentlich nicht möglich ist davon abzuweichen. Deshalb ACAB.
Die Parole ACAB, also »All Cops are Bastards«, meint genau das: Du kannst vielleicht ein guter Mensch sein, aber sobald du dich in das Polizeisystem begibst und Teil dieser Kultur wirst, dann kannst du kein guter Mensch bleiben. In meiner Forschung hatte ich zum Beispiel den Fall, dass eine Polizistin meinte, sie habe am Anfang sich noch gestört an dem täglichen Sexismus ihr gegenüber und auch was dagegen gesagt. Aber dann wurde sie dafür abgestraft, dass sie das kritisiert hatte – sie wurde ausgeschlossen und gemobbt. Also ist die Lösung, dass sie jetzt wieder mitlacht bei sexistischen Witzen, um in der Institution und im Polizeialltag zu überleben. Wer kein Teil der Cop Culture ist, dem wird es so schwer gemacht, dass es eigentlich nicht möglich ist davon abzuweichen. Deshalb ACAB.
Unter dem Begriff Abolitionismus wird die Abschaffung der Polizei und der Gefängnisse diskutiert. Wie blicken Sie als Kriminologin auf diese Debatte?
Ich halte die Abolitionismusdebatte für unfassbar wichtig, weil ich denke, dass die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Institution viel zu selbstverständlich ist. Man kann durch die Geschichte der Institution Polizei ja relativ leicht nachvollziehen, dass sie lediglich zur Wahrung und Durchsetzung der Interessen einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht entstanden ist und dass also andersherum auch eine bestimmte gesellschaftliche Schicht ins Visier des Gewaltmonopols gerät. Das ist eine Normalisierung von Ungleichheit durch Machtausübung und ich fände es gut, wenn wir das als Gesellschaft nicht einfach hinnehmen würden. Viele stellen sich die Abschaffung von Polizei und Gefängnissen als ganz schlimmen Zustand vor; alles außer Kontrolle, quasi. Aber es geht ja darum, Alternativen zu finden und mit Abweichung von der Norm einfach anders umzugehen. Wenn wir akzeptieren, dass es kein »Normal« gibt, sondern es konstruiert wird und mit Macht von oben durchgesetzt wird, dann wäre schon einiges getan. Natürlich kommen einem im jetzigen gesellschaftlichen Zustand abolitionistische Konzepte utopisch vor, aber ein System das problematisch ist, weil es so funktioniert wie es funktionieren soll, ist auch nicht reformierbar. Eine Gesellschaft, die mehr und mehr Ungleichheit produziert, können nur die Mächtigen gebrauchen. Und wenn man das nicht will, kann man nur versuchen neu zu denken.
