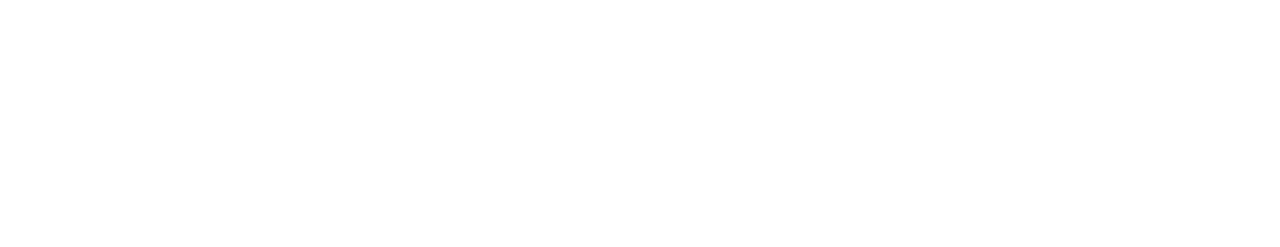»WERDEN SIE
VON MILLIONEN
KÖNIGEN EIN
KÖNIG.«
Besetzung
David
Schwarz
Schwarz
Live Musik
KONZEPTIONSPROBE
Am 02.11.2020 startete die Produktion DON KARLOS. Ein Eindruck der Konzeptionsprobe aus unserer Probebühne »Kupferzug«.
ZUM STÜCK
Zwölf Briefe schrieb Friedrich Schiller über DON KARLOS. Diese veröffentlichte er ein Jahr nach der Uraufführung 1788 in der Zeitschrift Teutsche Merkur, um sich gegen die zahlreichen Einwände, vor allem gegen die Rolle des Marquis von Posa, zu positionieren, den Schreibprozess offenzulegen und Einblicke in die Entwicklung der Figuren zu gewähren. Briefe spielen für Schiller nicht nur im Nachjustieren des DON KARLOS eine wichtige Rolle, auch im Stück selbst bedient er sich diesem künstlerischen Mittel: An unzähligen Briefen entspinnen sich die leidenschaftlichen Intrigen auf politischer und familiärer Ebene am spanischen Königshof des 16. Jahrhunderts.
Der Infant Don Karlos ist unglücklich in seine Stiefmutter Elisabeth von Valois verliebt. Ursprünglich war die Französin ihm versprochen, bis sie in die politisch motivierte Ehe mit seinem Vater, König Philipp II., einwilligte. Dieser entzieht Karlos nicht nur die Frau, sondern auch die Chance auf politische Verantwortung und jegliche Form väterlicher Zuneigung. Der Vater-Sohn-Konflikt spitzt sich bereits seit Jahren zu, doch Philipp kämpft an anderen Fronten: in den Niederlanden wüten Glaubenskriege des Achtzigjährigen Krieges, seine Machtposition droht ins Wanken zu geraten. Philipp beherrscht die Kunst der Verstellung, sein weltkluger Spürsinn legt sich über sein Handeln, sodass niemand ahnt, welche Abgründe sich darunter auftun.
Da taucht Karlos’ Jugendfreund Marquis von Posa auf. Schiller stattet ihn mit dem Ideenmaterial der Französischen Revolution aus, die sich während der Entstehung des Stücks schon am Horizont abbildet. Er sei »ein Bürger derer, die noch kommen werden«, wie er dem König mitteilt. In Schillers Briefen über DON KARLOS wird deutlich, wie viele seiner eigenen Ansichten der Dramatiker dem heimlichen Protagonisten des Stückes einschrieb. Der glühende Idealist hofft, in Karlos einen Mitstreiter zu finden, der die Flandrischen Provinzen von der spanischen Krone befreit. Karlos soll sich an die Spitze der niederländischen Autonomiebestrebung stellen und eine Rückkehr zur alten Verfassung und den ständischen Freiheiten erwirken. Königin Elisabeth wird zu Posas Komplizin, sie soll ihm helfen, Karlos’ Liebe für die Stiefmutter in Leidenschaft für Flandern umzulenken. Doch Herzog Alba hat einen anderen Plan für Flandern: Er selbst will mit einem Heer abreisen, die Revolte beenden und die Aufständischen gewaltsam niederschlagen. Zudem ist ihm das anwachsende Vertrauensverhältnis von Philipp II. zu Posa ein Dorn im Auge. Um seine Gunst betrogen, schließt er sich mit Domingo und Prinzessin Eboli zusammen. Im Fadenkreuz dieser beiden Pole verfängt sich der König, bis er nicht mehr zu wissen vermag, wem er trauen darf und wem nicht. Es entspinnt sich eine Serie an Missverständnissen und Komplotten, die Eifersucht und Einsamkeit befeuert und die moralische Überzeugung vor dem unterdrückten Wunsch nach Macht zurücktreten lässt.
Der Infant Don Karlos ist unglücklich in seine Stiefmutter Elisabeth von Valois verliebt. Ursprünglich war die Französin ihm versprochen, bis sie in die politisch motivierte Ehe mit seinem Vater, König Philipp II., einwilligte. Dieser entzieht Karlos nicht nur die Frau, sondern auch die Chance auf politische Verantwortung und jegliche Form väterlicher Zuneigung. Der Vater-Sohn-Konflikt spitzt sich bereits seit Jahren zu, doch Philipp kämpft an anderen Fronten: in den Niederlanden wüten Glaubenskriege des Achtzigjährigen Krieges, seine Machtposition droht ins Wanken zu geraten. Philipp beherrscht die Kunst der Verstellung, sein weltkluger Spürsinn legt sich über sein Handeln, sodass niemand ahnt, welche Abgründe sich darunter auftun.
Da taucht Karlos’ Jugendfreund Marquis von Posa auf. Schiller stattet ihn mit dem Ideenmaterial der Französischen Revolution aus, die sich während der Entstehung des Stücks schon am Horizont abbildet. Er sei »ein Bürger derer, die noch kommen werden«, wie er dem König mitteilt. In Schillers Briefen über DON KARLOS wird deutlich, wie viele seiner eigenen Ansichten der Dramatiker dem heimlichen Protagonisten des Stückes einschrieb. Der glühende Idealist hofft, in Karlos einen Mitstreiter zu finden, der die Flandrischen Provinzen von der spanischen Krone befreit. Karlos soll sich an die Spitze der niederländischen Autonomiebestrebung stellen und eine Rückkehr zur alten Verfassung und den ständischen Freiheiten erwirken. Königin Elisabeth wird zu Posas Komplizin, sie soll ihm helfen, Karlos’ Liebe für die Stiefmutter in Leidenschaft für Flandern umzulenken. Doch Herzog Alba hat einen anderen Plan für Flandern: Er selbst will mit einem Heer abreisen, die Revolte beenden und die Aufständischen gewaltsam niederschlagen. Zudem ist ihm das anwachsende Vertrauensverhältnis von Philipp II. zu Posa ein Dorn im Auge. Um seine Gunst betrogen, schließt er sich mit Domingo und Prinzessin Eboli zusammen. Im Fadenkreuz dieser beiden Pole verfängt sich der König, bis er nicht mehr zu wissen vermag, wem er trauen darf und wem nicht. Es entspinnt sich eine Serie an Missverständnissen und Komplotten, die Eifersucht und Einsamkeit befeuert und die moralische Überzeugung vor dem unterdrückten Wunsch nach Macht zurücktreten lässt.
ENTSTEHUNG
Als Vorlage für das Drama dient Schiller DON CARLOS, NOUVELLE HISTOIRE (1672) des Abbé de Saint-Réal, auf die der damalige Direktor des Mannheimer Nationaltheaters ihn aufmerksam machte. Aus Briefen, die Schiller im verschneiten Bauerbauch verfasste, geht sein Gemütszustand während der Vorbereitung deutlich hervor: »Endlich bin ich hier, glücklich und vergnügt, dass ich einmal am Ufer bin. Ich traf alles noch über meine Wünsche. Keine Bedürfnisse ängstigen mich mehr, kein Querstrich von außen soll meine dichterischen Träume, meine idealischen Täuschungen stören.« Der erste Entwurf von Schillers DON KARLOS legt das Augenmerk verstärkt auf das Familiendrama und die Liebesbeziehung zwischen Elisabeth und Don Karlos. Der Jugendfreund Marquis von Posa und die politische Tragödie sollen erst später in den Fokus rücken. Schiller schien nach dem FIESCO ZU GENUA, dessen politisches Sujet (1783) nicht gut aufgenommen worden war, nun etwas vorsichtiger, die öffentliche Annahme nicht zu gefährden.
Schiller bewährt sich im DON KARLOS eher als Geschichten- und weniger als Geschichtsschreiber. Der historische Carlos (1545-1568) galt nach einem Treppensturz im Jugendalter als körperlich angeschlagen, launisch, infantil und debil veranlagt. Dies schlug sich in mehrmaligen Gewaltaus- brüchen gegen den Vater nieder und mündete in dauerhafter Bewachung durch Philipp II. in einer Dachkammer. Er stirbt letztlich an einer Mageninfektion. Auch die Liebesbeziehung zwischen Elisabeth und dem Infanten ist nicht belegbar, der Maquis Posa gar frei erfunden.
Schiller arbeitet fünf Jahre an DON KARLOS, das Stück markiert in seinem Schaffen eine Wende vom Sturm und Drang zur Weimarer Klassik und durchlief verschiedene Phasen. Entstanden ist ein Drama, das Schiller bis zur finalen Version kurz vor seinem Tod 1805 nicht losließ, Kürzungen und Neuüberschreibungen durchlebte und sich zwischen Familiengemälde, politischer Tragödie, Geschichts- und Ideendrama bewegt und noch Aktualität beweist. Die politische Dimension der spanischen Inquisition, ihre Instrumente der Unterdrückung und Verschleierung zur Machterhaltung finden sich in abgewandelter Form wieder, schaute man dieses Jahr nach Belarus oder in die USA. Der Ausruf des Marquis von Posa, »Geben sie Gedankenfreiheit, Sire«, ist nicht nur der Schlüsselsatz des Dramas, sondern mittlerweile auf so mancher Corona-Demo zu vernehmen. Jedoch mit einem Beigeschmack, die Posas Formulierung nicht innewohnt. In Posa finden wir einen Kosmopoliten, der über eine moderne, europäische Gedankenwelt verfügt. Einen Liberalen mit humanitären Ideen, der den Beginn einer Zeitenwende symbolisiert.
Jürgen Flimm, ehemaliger Intendant des Schauspiel Köln (1979–1985) und langjähriger Leiter der Berliner Staatsoper Unter den Linden sowie des Thalia Theaters, kehrt mit diesem Klassiker nach Köln zurück.
Schiller bewährt sich im DON KARLOS eher als Geschichten- und weniger als Geschichtsschreiber. Der historische Carlos (1545-1568) galt nach einem Treppensturz im Jugendalter als körperlich angeschlagen, launisch, infantil und debil veranlagt. Dies schlug sich in mehrmaligen Gewaltaus- brüchen gegen den Vater nieder und mündete in dauerhafter Bewachung durch Philipp II. in einer Dachkammer. Er stirbt letztlich an einer Mageninfektion. Auch die Liebesbeziehung zwischen Elisabeth und dem Infanten ist nicht belegbar, der Maquis Posa gar frei erfunden.
Schiller arbeitet fünf Jahre an DON KARLOS, das Stück markiert in seinem Schaffen eine Wende vom Sturm und Drang zur Weimarer Klassik und durchlief verschiedene Phasen. Entstanden ist ein Drama, das Schiller bis zur finalen Version kurz vor seinem Tod 1805 nicht losließ, Kürzungen und Neuüberschreibungen durchlebte und sich zwischen Familiengemälde, politischer Tragödie, Geschichts- und Ideendrama bewegt und noch Aktualität beweist. Die politische Dimension der spanischen Inquisition, ihre Instrumente der Unterdrückung und Verschleierung zur Machterhaltung finden sich in abgewandelter Form wieder, schaute man dieses Jahr nach Belarus oder in die USA. Der Ausruf des Marquis von Posa, »Geben sie Gedankenfreiheit, Sire«, ist nicht nur der Schlüsselsatz des Dramas, sondern mittlerweile auf so mancher Corona-Demo zu vernehmen. Jedoch mit einem Beigeschmack, die Posas Formulierung nicht innewohnt. In Posa finden wir einen Kosmopoliten, der über eine moderne, europäische Gedankenwelt verfügt. Einen Liberalen mit humanitären Ideen, der den Beginn einer Zeitenwende symbolisiert.
Jürgen Flimm, ehemaliger Intendant des Schauspiel Köln (1979–1985) und langjähriger Leiter der Berliner Staatsoper Unter den Linden sowie des Thalia Theaters, kehrt mit diesem Klassiker nach Köln zurück.
MAKING-OF
Umzug ins Depot 1: Jürgen Flimm in der Arbeit mit den Schauspieler*innen und im Interview.
ZUM AUTOR
Das Deutsche Literaturarchiv Marbach erinnert seit 1999 jährlich mit einer Festrede an den Geburtstag von Friedrich Schiller. Die Redner*innen aus Kultur, Wissenschaft und Politik stellen darin Verbindungen zwischen ihrer Arbeit und dem Werk Schillers her, zeigen auf, inwiefern das kulturelle Erbe des Dramatikers auch heute noch von Relevanz ist.
Zwischen dem diesjährigen Redner Prof. Dr. Christian Drosten Virologie an der Charité Berlin, und dem 1759 in Marbach geborenem Autor lassen sich einige Parallelen ziehen. Beide studierten Medizin, doch ließen die praktizierende Medizin schnell hinter sich. Schiller verschrieb sich der Literatur, Drosten verschlug es in die wissenschaftliche Forschung. Zwei Werte sind für ihrer beider Arbeit elementar: Freiheit und Verpflichtung. Der Freiheitsbegriff nimmt in vielen Werken Schillers einen hohen Stellenwert ein, sie wird erkämpft, geschützt, verteidigt, gegeben und manchmal verloren. Nicht nur im Literarischen treibt sie ihn um, auch biografisch schien sie nicht selbstverständlich, wirft man einen Blick auf Schillers Lebensweg.
Streng erzogen, absolviert er zwischen 1773-1780 auf Befehl des Herzogs Karl Eugen eine militärisch-medizinische Ausbildung an der Karlsschule in Stuttgart. In diese Zeit fällt sein steigendes Interesse an Literatur, das jedoch nicht gefördert, vielmehr untersagt wird. Er wird Militärarzt, doch die Arbeit erfüllt ihn nicht. Heimlich liest er Goethe und Klopstock, schreibt an den ersten Zeilen des Dramas DIE RÄUBER, das 1782 in Mannheim zur Uraufführung kommt. Schillers unerlaubte Anwesenheit wird vom Herzog mit einem Schreibverbot hart bestraft. Der Dramatiker flieht aus Stuttgart und gelangt über Mannheim nach Bauerbach in Thüringen. Kurz zuvor hatte er die Arbeit an DIE VERSCHWÖRUNG DES FIESCO ZU GENUA abgeschlossen. In Bauerbach wird er unter dem Pseudonym »Dr. Ritter« untergebracht und schreibt an KABALE UND LIEBE, außerdem beginnt er mit der Arbeit an DON KARLOS und MARIA STUART. 1783 wird er kurzzeitig Theaterdichter in Mannheim, doch diese Zeit ist geplagt von Geldsorgen, der heimlichen Beziehung zu Charlotte von Kalb, Auseinandersetzungen mit der Theaterdirektion und einer Malaria-Infektion. Die Folgejahre verbringt er in Dresden, Weimar und Jena, wo er sich vermehrt historischen Studien sowie Gedichten und philosophischen Schriften zuwendet. Er lernt seine spätere Frau Charlotte von Lengefeld kennen und über sie auch Goethe. Er wird Teil der gehobenen Kreise des Weimarer Hofs. In den späten 1770ern schreibt Schiller verstärkt Lyrik aber auch an seiner Trilogie WALLENSTEIN, die mit großem Erfolg aufgenommen wird. Trotz der Anerkennung fühlt sich Schiller isoliert, glaubt sich aus dem Schatten Goethes nie vollends lösen zu können, selbst die Erhebung in den Adelsstand lässt ihn 1802 unberührt. Schiller stirbt nach langer Krankheit 1805 in Weimar. Freiheit blieb für ihn bis zu seinem Tod ein hohes Gut, für dessen Erhalt er einiges in Kauf nahm.
In seiner Schillerrede bezieht sich Christian Drosten auf den berühmten Satz aus DON KARLOS »Ich kann nicht Fürstendiener sein«, in dem der Wunsch nach Autonomie und Individualität mitschwingt. Auch Drosten wolle wie Marquis Posa ein Weltbürger und kein Fürstendiener sein. In der Gegenüberstellung zu Schillers Kampf um Eigenständigkeit ist er sich seines Privilegs bewusst, als Wissenschaftler frei und unabhängig zu forschen und die Erkenntnisse universell zur Verfügung zu stellen. Doch damit sei auch eine Verantwortung verbunden, denn der Geburtstag erinnere an einen wichtigen Vorsatz Schillers: »Es ist die Pflicht, die aus der Freiheit erwächst«. Für Drosten liegt diese darin, die Gesellschaft durch verantwortungsvolle Kommunikation an dem Erkenntnisprozess teilhaben zu lassen, sich bei negativer Presse nicht wegzuducken, sondern den Überzeugungen treu zu bleiben. Drosten schließt seine Rede mit einem Appell, den er ganz im Sinne Schillers entsendet: »Bewahren Sie sich die Freiheit und die Freude des Denkens.«
Zwischen dem diesjährigen Redner Prof. Dr. Christian Drosten Virologie an der Charité Berlin, und dem 1759 in Marbach geborenem Autor lassen sich einige Parallelen ziehen. Beide studierten Medizin, doch ließen die praktizierende Medizin schnell hinter sich. Schiller verschrieb sich der Literatur, Drosten verschlug es in die wissenschaftliche Forschung. Zwei Werte sind für ihrer beider Arbeit elementar: Freiheit und Verpflichtung. Der Freiheitsbegriff nimmt in vielen Werken Schillers einen hohen Stellenwert ein, sie wird erkämpft, geschützt, verteidigt, gegeben und manchmal verloren. Nicht nur im Literarischen treibt sie ihn um, auch biografisch schien sie nicht selbstverständlich, wirft man einen Blick auf Schillers Lebensweg.
Streng erzogen, absolviert er zwischen 1773-1780 auf Befehl des Herzogs Karl Eugen eine militärisch-medizinische Ausbildung an der Karlsschule in Stuttgart. In diese Zeit fällt sein steigendes Interesse an Literatur, das jedoch nicht gefördert, vielmehr untersagt wird. Er wird Militärarzt, doch die Arbeit erfüllt ihn nicht. Heimlich liest er Goethe und Klopstock, schreibt an den ersten Zeilen des Dramas DIE RÄUBER, das 1782 in Mannheim zur Uraufführung kommt. Schillers unerlaubte Anwesenheit wird vom Herzog mit einem Schreibverbot hart bestraft. Der Dramatiker flieht aus Stuttgart und gelangt über Mannheim nach Bauerbach in Thüringen. Kurz zuvor hatte er die Arbeit an DIE VERSCHWÖRUNG DES FIESCO ZU GENUA abgeschlossen. In Bauerbach wird er unter dem Pseudonym »Dr. Ritter« untergebracht und schreibt an KABALE UND LIEBE, außerdem beginnt er mit der Arbeit an DON KARLOS und MARIA STUART. 1783 wird er kurzzeitig Theaterdichter in Mannheim, doch diese Zeit ist geplagt von Geldsorgen, der heimlichen Beziehung zu Charlotte von Kalb, Auseinandersetzungen mit der Theaterdirektion und einer Malaria-Infektion. Die Folgejahre verbringt er in Dresden, Weimar und Jena, wo er sich vermehrt historischen Studien sowie Gedichten und philosophischen Schriften zuwendet. Er lernt seine spätere Frau Charlotte von Lengefeld kennen und über sie auch Goethe. Er wird Teil der gehobenen Kreise des Weimarer Hofs. In den späten 1770ern schreibt Schiller verstärkt Lyrik aber auch an seiner Trilogie WALLENSTEIN, die mit großem Erfolg aufgenommen wird. Trotz der Anerkennung fühlt sich Schiller isoliert, glaubt sich aus dem Schatten Goethes nie vollends lösen zu können, selbst die Erhebung in den Adelsstand lässt ihn 1802 unberührt. Schiller stirbt nach langer Krankheit 1805 in Weimar. Freiheit blieb für ihn bis zu seinem Tod ein hohes Gut, für dessen Erhalt er einiges in Kauf nahm.
In seiner Schillerrede bezieht sich Christian Drosten auf den berühmten Satz aus DON KARLOS »Ich kann nicht Fürstendiener sein«, in dem der Wunsch nach Autonomie und Individualität mitschwingt. Auch Drosten wolle wie Marquis Posa ein Weltbürger und kein Fürstendiener sein. In der Gegenüberstellung zu Schillers Kampf um Eigenständigkeit ist er sich seines Privilegs bewusst, als Wissenschaftler frei und unabhängig zu forschen und die Erkenntnisse universell zur Verfügung zu stellen. Doch damit sei auch eine Verantwortung verbunden, denn der Geburtstag erinnere an einen wichtigen Vorsatz Schillers: »Es ist die Pflicht, die aus der Freiheit erwächst«. Für Drosten liegt diese darin, die Gesellschaft durch verantwortungsvolle Kommunikation an dem Erkenntnisprozess teilhaben zu lassen, sich bei negativer Presse nicht wegzuducken, sondern den Überzeugungen treu zu bleiben. Drosten schließt seine Rede mit einem Appell, den er ganz im Sinne Schillers entsendet: »Bewahren Sie sich die Freiheit und die Freude des Denkens.«
LITERARISCHES QUARTETT
Marcel Reich-Ranicki, Iris Radisch, Hellmuth Karasek und Elke Heidenreich widmen sich in einem SchillerSpezial aus dem Jahr 2005 dem Schaffen des Dichters und Dramatikers Friedrich Schiller und diskutieren über seine Werke Don Karlos, Wallenstein, Die Räuber und Kabale und Liebe.
INTERVIEW
Tag der Generalprobe: Nicolas Lehni (Marquis Posa) und Marek Harloff (Don Karlos) sprechen mit der Dramaturgin Lea Goebel über ihre Figuren, das erste Zusammentreffen mit Jürgen Flimm und und die Arbeit an der Live-Stream Premiere.
EIN MANN FÜR 1-20 KÖLSCH
WOLFGANG NIEDECKEN, ELKE HEIDENREICH UND JÜRGEN BECKER
ÜBER DEN THEATERMACHER JÜRGEN FLIMM
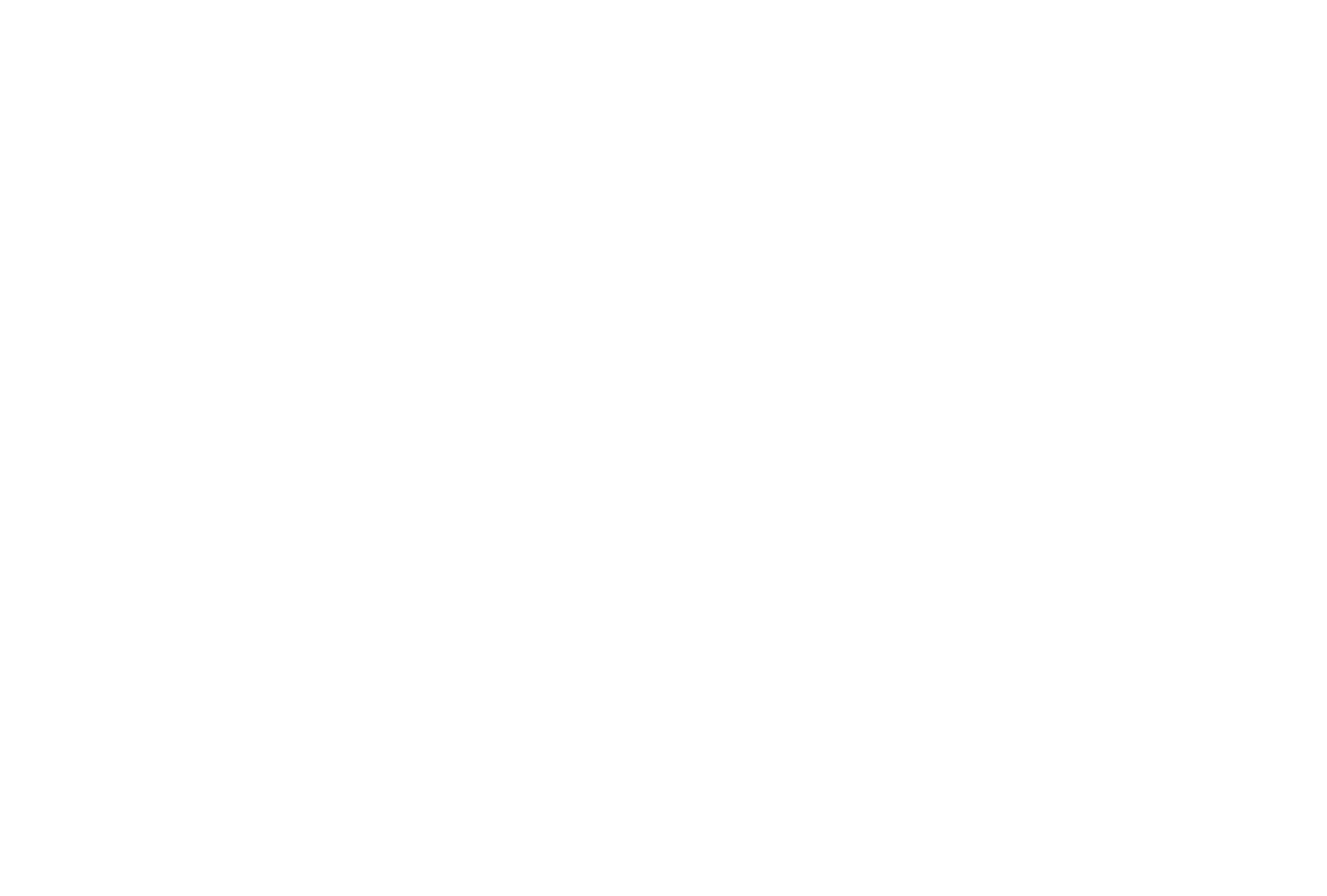
2. September 1979: Auftritt im Rahmen des Sommerfestes des Kölner Schauspielhauses, zu dem ich von Jürgen Flimm, dem neuen Intendanten engagiert worden war. Ich gab einige meiner neuen selbstverfassten Songs zum Besten. Es muss ihm gefallen haben, denn kurz darauf kam die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, für sein Haus eine Art Rockoperette zu schreiben. Klar doch! Ich grub in der Folge die Kölsche Sage von »Jan und Griet« aus, versetzte sie in die Gegenwart, und schrieb Songs dafür. Eigentlich stand der Verwirklichung des Projektes nichts mehr groß im Wege, außer: Am Kölner Schauspielhaus fanden sich definitiv keine Schauspieler, die der kölschen Sprache mächtig waren und so langsam aber sicher wurden wir immer bekannter und die »Jan und Griet«-Story in der proportionalen Umkehrung immer unaufführbarer, koketter, weil sie schließlich von einem erfolglosen kölschen Musiker handelte, der von seiner Angebeteten ob dieses Mankos abgewiesen wird.
»Ejal. Et kütt wie et kütt un usserdämm ess et noch immer joot jejange.« Vielleicht auch deshalb, weil uns der - als überzeugter Kölner - im Grunde seines Herzens wertkonservative Jürgen Flimm immer wieder eindrucksvoll vorgelebt hat, dass man »sein Ding« machen muss, von dem man überzeugt ist und dass es stillos ist, auf jede beliebige Sau zu springen, die grade durch's Dorf getrieben wird. Sein Ding ist das Theater der klassischen Moderne und nicht der spektakuläre postmoderne Unsinn, der mancherorts kurzfristig mehr Aufmerksamkeit erheischt, dem aber über längere Strecken zwangsläufig die Puste ausgehen muss. Ich danke ihm dafür, nie sein Fähnchen in den Wind gehängt zu haben, dafür dass er – Zeitgeist hin, Zeitgeist her – immer dazu gestanden hat, dass für ihn Kultur etwas mit Aufklärung (nicht Bevormundung!) und mit Engagement für die gerechte Sache zu tun hat. Ohne Einmischer seines Schlages wäre unser Land arm dran. (Wolfgang Niedecken, Musiker)
Das ist der Mann, mit dem man immer gern 1-20 Kölsch trinkt. Und dann fängt man an mit dem Satz »Wie geht's?« und landet bei den alten Griechen oder den neuen Schnäpsen. Und einmal, als ich zum allererstenmal in New York war, frisch aus dem Hotel kam und mutig in die große weite Welt eintrat, da begegnete ich genau seinem guten, verschmitzten Gesicht auf einem Flohmarkt und dachte: Sehen nett aus, die diese New Yorker - denn wer vermutet ihn schon so weit weg von zuhause! Aber er ist eben immer da zuhause, wo gutes Theater ist, damals war das Bob Wilson in New York. Und einmal durfte ich in seinem Theater auf der großen Bühne lesen, dazu hatte ich mein eben damals in New York gekauftes grünes Samtkleid an und war sehr elegant und aufgeregt, und er, der Intendant? Schlurfte in ollen Jeans und Pullover hinter der Bühne herum, hörte aber ganz und gar zu, und ach, er kann so wunderbar loben und in den Arm nehmen, da müssen andere noch viel lernen. Und ab und zu, wenn ich eine neue Geschichte geschrieben habe, dann kommt ein kleines Briefchen von ihm, kurz liebevoll, aufmerksam, dafür hat er tatsächlich Zeit, und ich liebe ihn dafür, den Stillen, Klugen, Sensiblen, der alles merkt hinter seiner Brille und der weiß, wie allein man sein kann. Er fehlt uns in der Provinz Köln, in jeder Hinsicht. Dass er nun nach Österreich geht... nun gut. Jeder muss wissen, womit er glücklich wird. Der kommt schon noch zurück nach Köln. Und dann werden wir sowieso zusammen alt. Und trinken 1-20 Kölsch. Schon morgens, beim Früh am Chlodwigplatz.
(Elke Heidenreich, Schriftstellerin)
Dellbrück. Der eine und der andere Jürgen, sie stammen beide aus dem rechtsrheinischen Kölner Vorort; die beiden Straßen mit unseren Elternhäusern, Gemarkenstraße und Strundener Straße, berühren einander. Der Name Flimm war schon vor den Brüdern Jürgen und Dieter in Dellbrück ein berühmter: Kaum ein Ortsansässiger, der nicht hei Vater und dann Mutter Flimm die ärztliche Praxis aufgesucht hätte - »isset schlimm, jeh zu Flimm«, seufzte meine Großmutter, als ihr beim Gartenumgraben das Handgelenk brach; der ganze Vorort hielt sich daran. Preussen Dellbrück, ewig Bezirksklasse, bis 1946 der Aufstieg in die West gelang, 1948 der heroische Abstiegsmarathon gegen Vohwinkel 80, 1950 westdeutscher Vizemeiste ... der Junge aus der Thurner Straße, die zwischen unseren Elternhäusern die Gemarkenstraße kreuzt, immer im Tor. Diese Fangtechnik, diese Robin- sonaden im Strafraum, diese Faustabwehr! Und immer, wenn er vor Spielbeginn in sein Tor trabte, setzte er sich diese alte, eingekniffene Landsermütze auf.
Was er einzig fürchtete, der Fritz, waren die unvorhersehbaren Ballrückgaben von Heinz Schlömer, dem baumlangen Dellbrücker Mittelläufer aus Poll. Nur als der Sohn des Dellbrücker Schulrektors sich dann ins Linksrheinische, zum 1. FC Köln hinüberziehen ließ, nicht wahr, Jürgen Flimm, diesen Seitenwechsel, diesen Schock mussten wir ganz hart verdrängen. Rot-Weiß Essen, na ja, immerhin stieg dort Herkenraths Fritz zum Nationaltormann auf. Die Dellbrücker Jugend, sie hatte mit solchen Erfahrungen um den Sportlatz an der Bergisch-Gladbacher Straße herum vielleicht etwas Gemeinsames, auch wenn wir uns dort nie über den Weg gelaufen sind. Auch nicht auf dem Schulhof vom Deutzer Gymnasium. Der Jürgen Flimm war eben der um einige Jahre Jüngere. Und jetzt weiß man ihn auch selten in wenig veränderten Heimat unseres Vororts. Weshalb ich mir der alten, immer von Clärchen und Hermann Baus vom »jürjen« in Hamburg erzählen lassen muss, manchmal, wenn ich in Dellbrück zuhause bei den gemeinsamen Freunden sitze, die oft nach dem Norden hoch fahren, um dort die Fotos zu machen von Jürgen Flimms Theaterkunst. (Jürgen Becker, Schriftsteller)
»Ejal. Et kütt wie et kütt un usserdämm ess et noch immer joot jejange.« Vielleicht auch deshalb, weil uns der - als überzeugter Kölner - im Grunde seines Herzens wertkonservative Jürgen Flimm immer wieder eindrucksvoll vorgelebt hat, dass man »sein Ding« machen muss, von dem man überzeugt ist und dass es stillos ist, auf jede beliebige Sau zu springen, die grade durch's Dorf getrieben wird. Sein Ding ist das Theater der klassischen Moderne und nicht der spektakuläre postmoderne Unsinn, der mancherorts kurzfristig mehr Aufmerksamkeit erheischt, dem aber über längere Strecken zwangsläufig die Puste ausgehen muss. Ich danke ihm dafür, nie sein Fähnchen in den Wind gehängt zu haben, dafür dass er – Zeitgeist hin, Zeitgeist her – immer dazu gestanden hat, dass für ihn Kultur etwas mit Aufklärung (nicht Bevormundung!) und mit Engagement für die gerechte Sache zu tun hat. Ohne Einmischer seines Schlages wäre unser Land arm dran. (Wolfgang Niedecken, Musiker)
Das ist der Mann, mit dem man immer gern 1-20 Kölsch trinkt. Und dann fängt man an mit dem Satz »Wie geht's?« und landet bei den alten Griechen oder den neuen Schnäpsen. Und einmal, als ich zum allererstenmal in New York war, frisch aus dem Hotel kam und mutig in die große weite Welt eintrat, da begegnete ich genau seinem guten, verschmitzten Gesicht auf einem Flohmarkt und dachte: Sehen nett aus, die diese New Yorker - denn wer vermutet ihn schon so weit weg von zuhause! Aber er ist eben immer da zuhause, wo gutes Theater ist, damals war das Bob Wilson in New York. Und einmal durfte ich in seinem Theater auf der großen Bühne lesen, dazu hatte ich mein eben damals in New York gekauftes grünes Samtkleid an und war sehr elegant und aufgeregt, und er, der Intendant? Schlurfte in ollen Jeans und Pullover hinter der Bühne herum, hörte aber ganz und gar zu, und ach, er kann so wunderbar loben und in den Arm nehmen, da müssen andere noch viel lernen. Und ab und zu, wenn ich eine neue Geschichte geschrieben habe, dann kommt ein kleines Briefchen von ihm, kurz liebevoll, aufmerksam, dafür hat er tatsächlich Zeit, und ich liebe ihn dafür, den Stillen, Klugen, Sensiblen, der alles merkt hinter seiner Brille und der weiß, wie allein man sein kann. Er fehlt uns in der Provinz Köln, in jeder Hinsicht. Dass er nun nach Österreich geht... nun gut. Jeder muss wissen, womit er glücklich wird. Der kommt schon noch zurück nach Köln. Und dann werden wir sowieso zusammen alt. Und trinken 1-20 Kölsch. Schon morgens, beim Früh am Chlodwigplatz.
(Elke Heidenreich, Schriftstellerin)
Dellbrück. Der eine und der andere Jürgen, sie stammen beide aus dem rechtsrheinischen Kölner Vorort; die beiden Straßen mit unseren Elternhäusern, Gemarkenstraße und Strundener Straße, berühren einander. Der Name Flimm war schon vor den Brüdern Jürgen und Dieter in Dellbrück ein berühmter: Kaum ein Ortsansässiger, der nicht hei Vater und dann Mutter Flimm die ärztliche Praxis aufgesucht hätte - »isset schlimm, jeh zu Flimm«, seufzte meine Großmutter, als ihr beim Gartenumgraben das Handgelenk brach; der ganze Vorort hielt sich daran. Preussen Dellbrück, ewig Bezirksklasse, bis 1946 der Aufstieg in die West gelang, 1948 der heroische Abstiegsmarathon gegen Vohwinkel 80, 1950 westdeutscher Vizemeiste ... der Junge aus der Thurner Straße, die zwischen unseren Elternhäusern die Gemarkenstraße kreuzt, immer im Tor. Diese Fangtechnik, diese Robin- sonaden im Strafraum, diese Faustabwehr! Und immer, wenn er vor Spielbeginn in sein Tor trabte, setzte er sich diese alte, eingekniffene Landsermütze auf.
Was er einzig fürchtete, der Fritz, waren die unvorhersehbaren Ballrückgaben von Heinz Schlömer, dem baumlangen Dellbrücker Mittelläufer aus Poll. Nur als der Sohn des Dellbrücker Schulrektors sich dann ins Linksrheinische, zum 1. FC Köln hinüberziehen ließ, nicht wahr, Jürgen Flimm, diesen Seitenwechsel, diesen Schock mussten wir ganz hart verdrängen. Rot-Weiß Essen, na ja, immerhin stieg dort Herkenraths Fritz zum Nationaltormann auf. Die Dellbrücker Jugend, sie hatte mit solchen Erfahrungen um den Sportlatz an der Bergisch-Gladbacher Straße herum vielleicht etwas Gemeinsames, auch wenn wir uns dort nie über den Weg gelaufen sind. Auch nicht auf dem Schulhof vom Deutzer Gymnasium. Der Jürgen Flimm war eben der um einige Jahre Jüngere. Und jetzt weiß man ihn auch selten in wenig veränderten Heimat unseres Vororts. Weshalb ich mir der alten, immer von Clärchen und Hermann Baus vom »jürjen« in Hamburg erzählen lassen muss, manchmal, wenn ich in Dellbrück zuhause bei den gemeinsamen Freunden sitze, die oft nach dem Norden hoch fahren, um dort die Fotos zu machen von Jürgen Flimms Theaterkunst. (Jürgen Becker, Schriftsteller)
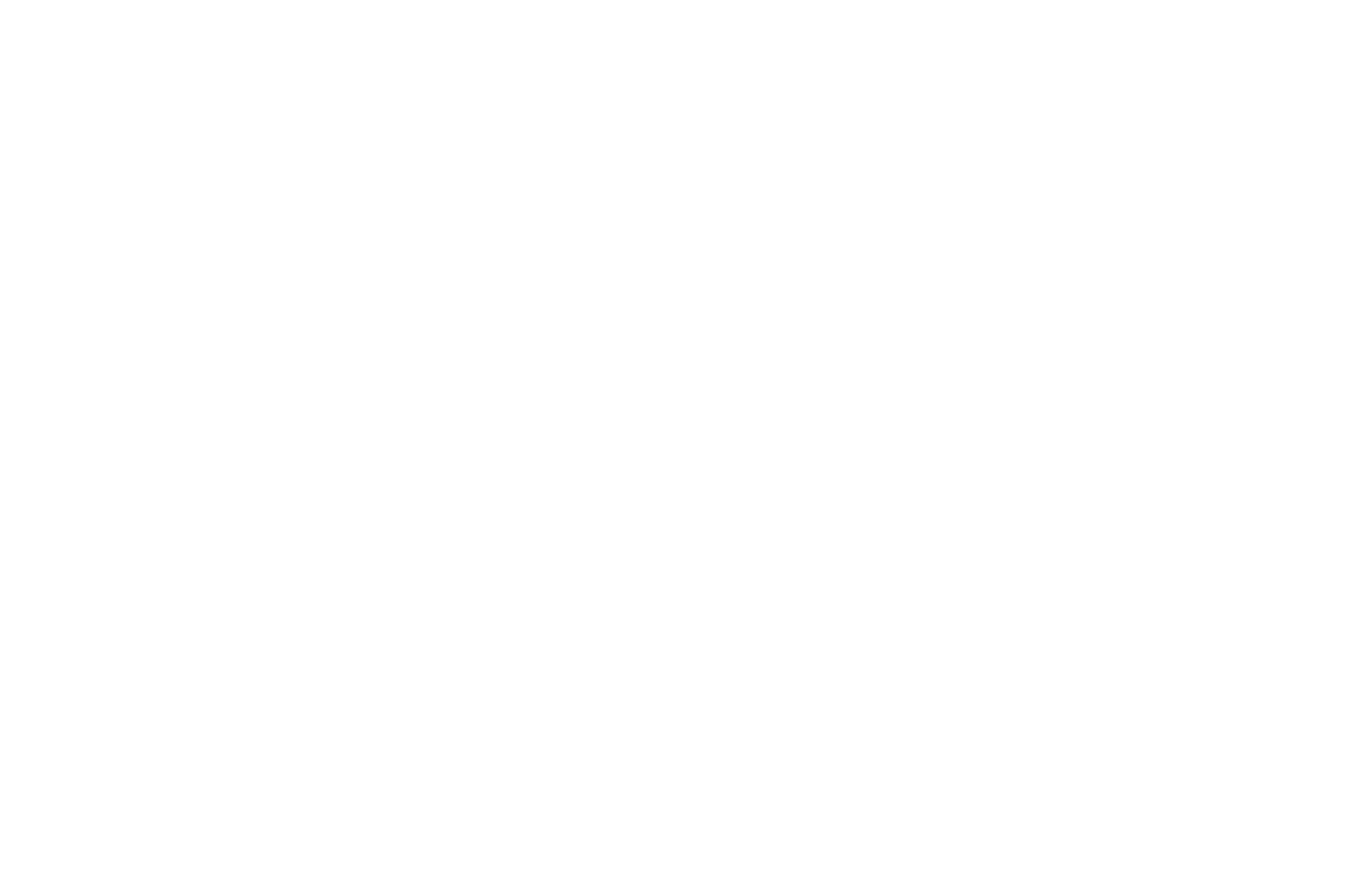
Regie: Jürgen Flimm
Bühne: GEORGE TSYPIN
Mitarbeit Bühne: Claudia Vaes
Kostüm: POLINA LIEFERS
Video: ROCAFILM
Licht: Michael Gööck
Dramaturgie: Lea Goebel
KOMPOSITION, LIVE-MUSIK: DAVID SCHWARZ