digitales
PROGRAMMHEFT
BALLET OF (DIS)OBEDIENCE
von Richard Siegal / Ballet of Difference
Depot 1
Eine Produktion von Schauspiel Köln und Tanz Köln
Uraufführung: 24. März 2023
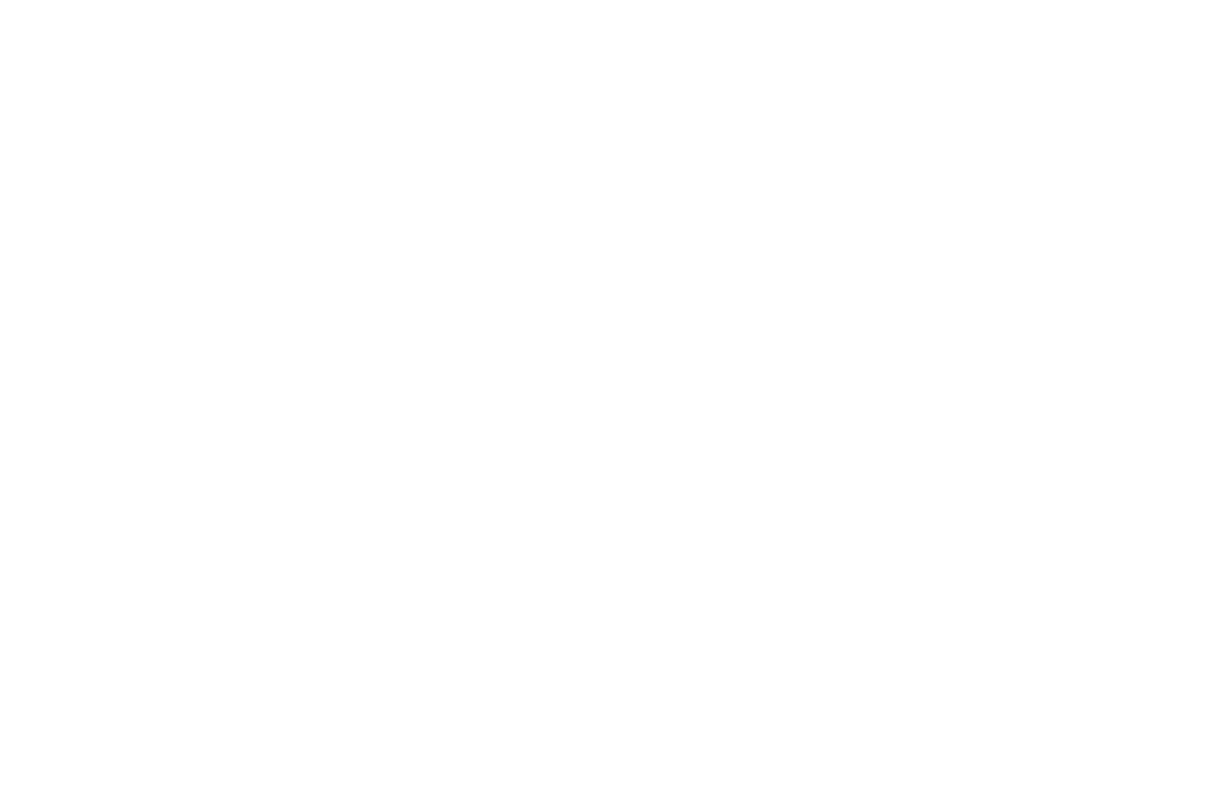
Thomas Schermer
INHALTSVERZEICHNIS
Besetzung
Team
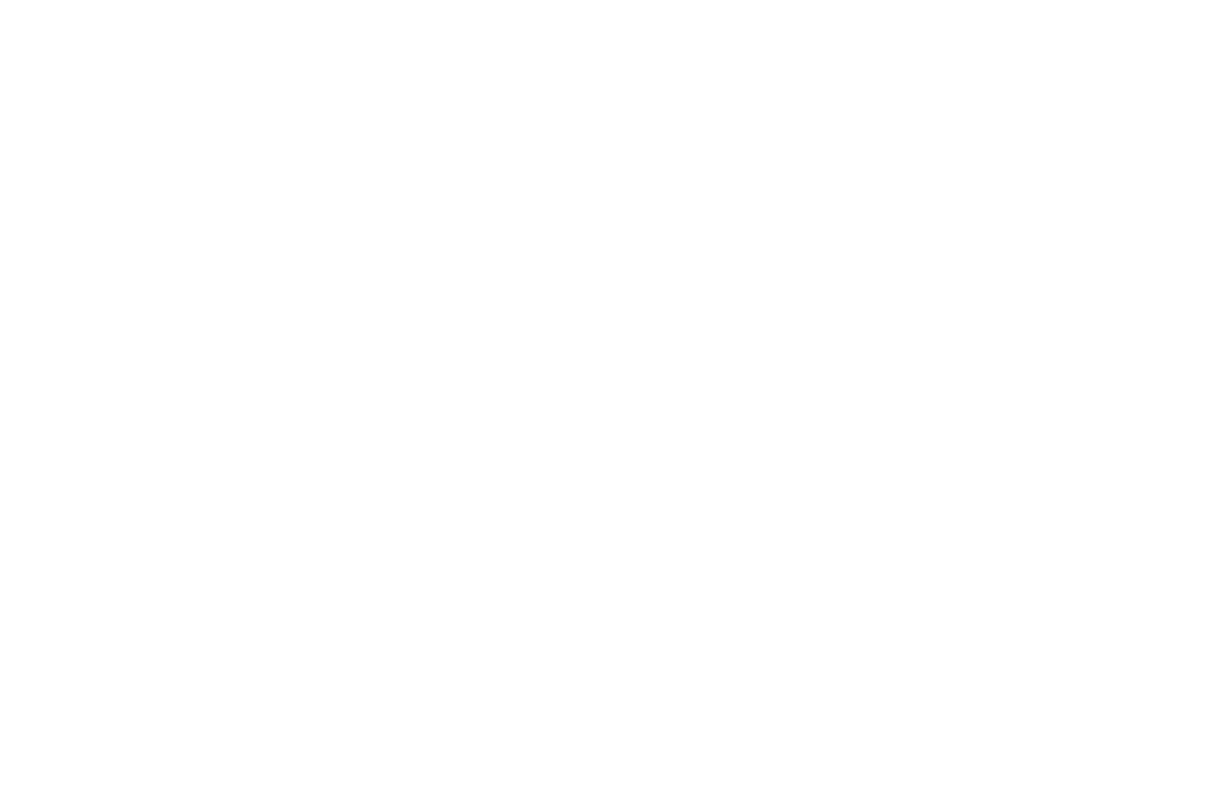
Thomas Schermer
Choreografie & Bühne: Richard Siegal
Kostüme: Flora Miranda
Licht & Video: Matthias Singer
Musik: Alva Noto
Dramaturgie: Tobias Staab
PROBENLEITUNG: Ana Presta • BÜHNENBILDASSISTENZ: Lucie Hedderich • KOSTÜMASSISTENZ: Wiebke Barbara • INSPIZIENZ: Andreas Friedemann • TECHNISCHE PRODUKTIONSLEITUNG: NIKO MODDENBORG • KÜNSTLERISCHE PRODUKTIONSLEITUNG: Josefine Pfütze • COMPANY MANAGEMENT: URSULA TEICH •
TOURMANAGEMENT: ECOTOPIA DANCE PRODUCTIONS
BÜHNENTECHNIK: Martin Krutmann • BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG: Hannes Grethe, Fabian Ferri • TONTECHNIK: Oliver Bersin, Christoph Priebe • VIDEO: Nils Jaeger, Christoph Odendahl, Paul Schwarz • PRODUKTIONSLEITUNG: Oliver Haas, Petra Möhle, Jan Müller • STELLVERTR. LTG. WERKSTÄTTEN: Ilya Pfaller
DEKORATIONSAUSFÜHRUNG: Martin Arenz, Florian Hohenkamp, Frank Hohmann, Boris Thelen, Daniel Vogt, Wencke Wesemann • KOSTÜMAUSFÜHRUNG: Johanna Biehl, Daniela Hunke, Simone Gartner-Brochhaus, Elke Scholz, Sabine Reschke • SCHUHMACHEREI: Sonja Storz • KOSTÜMMALEREI: Gudrun Fuchs, Marja Adade • ANKLEIDER*INNEN: Moez Ben Brahim, Katja Böhm, Eva Gamble • MASKENBILD: Birgit Herber
SHUUDAN KOUDOU Glossar
|
気をつけ |
KIOTUKE | ATTENTION | ACHTUNG |
| 休め | YASUME | RELAX | RÜHRT EUCH |
| 全体進め | ZENTAI SUSUME | EVERYBODY WALK | VORWÄRTS MARSCH |
| 回れ右 | MAWARE MIGI | EVERYBODY FLIP | ABTEILUNG KEHRT |
| 右向け右 | MIGI MUKE MIGI | RIGHT FACE RIGHT | RECHTS UM |
| 左向け左 | HIDARI MUKE HIDARI | LEFT FACE LEFT | LINKS UM |
| 全体止まれ | ZENTAI TOMARE | EVERYBODY STOP | ABTEILUNG HALT |
| 整列 | SEIRETU | FALL IN | AUFSCHLIEßEN |
| 並べ | NARABE LINE UP STILL-GESTANDEN |
LINE UP | STILL-GESTANDEN |
| 一 | ICHI | ONE | EINS |
| ニ | NI | TWO | ZWEI |
| 三 | SAN | THREE | DREI |
| 四 | SHU | FOUR | VIER |
30 % Unsicherheit, 70 % Vertrauen
Auszüge eines Berichtes über eine Begegnung
Tobias Staab
Das international zusammengestellte Ballet of Difference-Ensemble beschäftigt sich über mehrere Jahre mit unterschiedlichen Tanz- und Bewegungskulturen und versucht dabei, die eigene Verortung in Zentraleuropa mit zu reflektieren. Für den Choreografen Richard Siegal war die japanische Disziplin des »Japanese Pression Walking« (jap. »Shuudan Koudou«) bereits bei seinem Stück UNITXT (2013, Bayerisches Staatsballett) eine große Inspiration. Im August 2022 reist er mit Unterstützung des Goethe-Instituts gemeinsam mit seiner gesamten Kompanie zusammen nach Japan, um die Technik des »Shuudan Koudou« zu lernen. Der interkulturelle Austausch, der in Japan stattfindet, soll als Basis für das neue Stück BALLET OF (DIS)OBEDIENCE dienen. Inhaltlich konzentriert sich die Arbeit auf das Verhältnis von Individualität und Kollektivität, mithin: Auf das Verhältnis einer mitteleuropäischen Gesellschaft gegenüber einer ostasiatischen. Die Praxis des »Shuudan Koudou«, die in Japan eher als Sportart, denn als Kunstform verstanden wird, findet in der Regel an Universitäten statt. Mit Hilfe des in Akasaka/Tokio gelegenen Goethe-Instituts, wurden Kontakte zu der Sportuniversität in Yokohama geknüpft. Dort gibt der Trainer Mr. Omi auf ehrenamtlicher Basis sein Wissen an die Student*innen weiter. Dieser Bericht zeichnet die Begegnung zwischen den klassisch ausgebildeten Ballettänzer*innen aus Köln und den japanischen »Shuudan-Koudou«-Student*innen nach.
29.08.2022
Nachdem wir am Vortag gelandet sind und uns mit Tokio ein wenig vertraut gemacht haben, steht das erste Training an der Sportuniversität Yokohama an. Zu unserem ersten Treffen nach Yokohama fahren wir gemeinsam. Vom Hotel in Akasaka/Tokio dauert die Anreise ca. eineinhalb Stunden. Nach einer längeren Fahrt mit dem Stadtzug steigen wir in einen Bus um, der uns an die Universität bringt. Wir treffen uns mit unserem Übersetzer Kazuma Glen Motomura, den Richard Siegal von früheren Projekten her kennt. Kazuma kommt aus der Urbanen Dance/Battle-Szene, hat japanische und südafrikanische Wurzeln und wohnt derzeit zwischen Berlin und Tokio. Er wird uns nicht nur das übersetzen, was gesagt wurde, sondern auch viel Unausgesprochenes verständlich machen. An der Universität in Yokohama angekommen, treffen wir bald die ersten »Shuudan-Koudou«-Student*innen und ihren Trainer Mr. Omi, den Richard Siegal und ich bereits über einen vom Goethe-Institut vermittelten Video-Call von Deutschland aus kennengelernt hatten. Das Training findet in einer alten Turnhalle mit 70er-Jahre-Holzparkett statt. Gemeinsam mit den ca. 40 Student*innen wärmen sich die Ballet-of-Difference-Tänzer*innen auf. Um 19:00 beginnt das zweistündige Training. Nach einer Begrüßung durch Mr. Omi lernen die Tänzer*innen einige Grundschritte des Shuudan Koudou. In erster Linie scheint es darum zu gehen, als geometrischer Menschen-Block im Gleichschritt zu marschieren. Herausforderungen bilden Richtungswechsel, bei denen ein geordnetes Marschieren nach rechts oder links, später auch der abrupte Richtungswechsel in die Gegenrichtung geprobt wird. Die Befehle, die diese Wechsel ankündigen, werden von Mr. Omi auf japanisch eingerufen und durch unseren Übersetzer Kazuma verständlich gemacht. Auch dieser Rhythmus muss erst erprobt werden. Zuerst wird als große Gruppe trainiert, dann bilden sich Kleingruppen, in deren Rahmen sich mehrere japanische Student*innen um die Tänzer*innen kümmern und ihnen mehr physisch als verbal Details der Bewegungen vermitteln. Nach zwei Stunden sind einige Grundschritte verstanden. Am Ende jeder Trainings-Session setzen sich die Student*innen und Tänzer*innen gemeinsam in Reih und Glied nieder – streng choreografiert nach einem dreistufigen System – um Mr. Omis Reflexion über die Trainingseinheit zu empfangen. Gegen 23:00 Uhr kommen wir wieder im Hotel in Akasaka an.
[...]
[...]
30.08.2022
Die Proben für »Shuudan Koudou« sind wöchentlich dreimal für Montag, Mittwoch und Freitag in Yokohama angesetzt. Für die BOD-Tänzer*innen sind die anderen Wochentage durch zusätzliche Proben im Architanz-Zentrum in Tokio definiert, wo auch das tägliche Ballett-Training in Form offener Ballet-Classes stattfindet. In diesen Proben sollen die Erfahrungen des »Shuudan-Koudou«-Trainings verbal, aber auch körperlich reflektiert werden. Außerdem beginnen in diesem Kontext bereits die Proben an BALLET OF (DIS)OBEDIENCE.
Die Tänzer*innen sind sich einig, dass es großen Spaß gemacht hat. Am Anfang sei das Training sehr stressig gewesen, weil sie die japanischen Befehle nicht verstanden haben, aber je länger sie dabei waren, desto mehr Vergnügen habe es bereitet. Eine Tänzerin fühlt sich an ihre Ballett-Ausbildung erinnert. Auch dort habe sie einen großen Leistungsdruck verspürt, der immer verlangte, keine Fehler zu machen. Wir fragen uns gemeinsam, ob »Shuudan Koudou« im Hinblick auf ein kollektives Bewusstsein mit der Praxis »Corps de Ballet« verwandt sei. Und wir fragen uns, ob »Non-Individuality« im Sinne eines Gegenteils von Individualität als Wert für uns vorstellbar wäre.
Außerdem kommt ein Gespräch in der Gruppe auf, bei dem die Frage der kulturellen Aneignung verhandelt wird. Handelt es sich bei unserer Unternehmung um kulturelle Aneignung? Dabei wurde auch diskutiert, ob es sich bei »Shuudan Koudou« um einen Sport oder um eine Kunstform handelt. Würde man, so eine Frage, auch noch von einer kulturellen Aneignung sprechen, wenn es sich »lediglich« um einen Sport handeln würde? Wir versuchen also unterschiedliche Kriterien zu finden, um bewerten zu können, wann beziehungsweise in welcher Form es sich um eine kulturelle Aneignung handeln könnte. Als erstes fällt der Begriff Respekt. In diesem Zusammenhang wird nach der genauen Beschaffenheit des Austauschs gefragt, mithin, ob es sich überhaupt um einen kulturellen Austausch handelt. Was können wir dafür tun, damit ein kultureller Austausch wirklich zu Stande kommt? Was, so die Frage, die als Konsequenz aus diesen Gedanken hervorgeht, können wir anbieten, dass wir im Austausch für das hier in Japan erlangte Wissen und die erlernten Fähigkeiten zurückgeben?
Das Gespräch geht schließlich zur Fragestellung Individualität versus Kollektivität über. Handelt es sich dabei um einen Dualismus, um eine Opposition? Oder könnte das Begriffspaar auch von einer anderen Perspektive betrachtet werden? Gibt es etwas dazwischen? Eine Art Kompromiss? Ein Tänzer spricht davon, dass er versucht habe, beim »Shuudan Koudou« so zu sein, wie alle anderen, was er als Erleichterung empfunden habe. Eine Art besänftigendes Gegenüber zu dem Druck, der von Innovation und Individualität beim Ballett her rührt. Ein anderer Tänzer bemerkt, dass er eine Art Freiheit darin erkennen kann, weniger Wahlmöglichkeiten zu haben. Oder handelt es sich um eine Art Simplizität, die Einfachheit eines Systems von Regeln und die Entscheidung, diese Regeln zu befolgen? Wir versuchen das Ganze auf einen größeren gesellschaftlichen Rahmen zu spannen: Was sind die Koordinaten für Glück? Muss es dabei um Individualität gehen oder kann eine kollektive Gesellschaft sogar glücklicher sein?
[...]
Die Tänzer*innen sind sich einig, dass es großen Spaß gemacht hat. Am Anfang sei das Training sehr stressig gewesen, weil sie die japanischen Befehle nicht verstanden haben, aber je länger sie dabei waren, desto mehr Vergnügen habe es bereitet. Eine Tänzerin fühlt sich an ihre Ballett-Ausbildung erinnert. Auch dort habe sie einen großen Leistungsdruck verspürt, der immer verlangte, keine Fehler zu machen. Wir fragen uns gemeinsam, ob »Shuudan Koudou« im Hinblick auf ein kollektives Bewusstsein mit der Praxis »Corps de Ballet« verwandt sei. Und wir fragen uns, ob »Non-Individuality« im Sinne eines Gegenteils von Individualität als Wert für uns vorstellbar wäre.
Außerdem kommt ein Gespräch in der Gruppe auf, bei dem die Frage der kulturellen Aneignung verhandelt wird. Handelt es sich bei unserer Unternehmung um kulturelle Aneignung? Dabei wurde auch diskutiert, ob es sich bei »Shuudan Koudou« um einen Sport oder um eine Kunstform handelt. Würde man, so eine Frage, auch noch von einer kulturellen Aneignung sprechen, wenn es sich »lediglich« um einen Sport handeln würde? Wir versuchen also unterschiedliche Kriterien zu finden, um bewerten zu können, wann beziehungsweise in welcher Form es sich um eine kulturelle Aneignung handeln könnte. Als erstes fällt der Begriff Respekt. In diesem Zusammenhang wird nach der genauen Beschaffenheit des Austauschs gefragt, mithin, ob es sich überhaupt um einen kulturellen Austausch handelt. Was können wir dafür tun, damit ein kultureller Austausch wirklich zu Stande kommt? Was, so die Frage, die als Konsequenz aus diesen Gedanken hervorgeht, können wir anbieten, dass wir im Austausch für das hier in Japan erlangte Wissen und die erlernten Fähigkeiten zurückgeben?
Das Gespräch geht schließlich zur Fragestellung Individualität versus Kollektivität über. Handelt es sich dabei um einen Dualismus, um eine Opposition? Oder könnte das Begriffspaar auch von einer anderen Perspektive betrachtet werden? Gibt es etwas dazwischen? Eine Art Kompromiss? Ein Tänzer spricht davon, dass er versucht habe, beim »Shuudan Koudou« so zu sein, wie alle anderen, was er als Erleichterung empfunden habe. Eine Art besänftigendes Gegenüber zu dem Druck, der von Innovation und Individualität beim Ballett her rührt. Ein anderer Tänzer bemerkt, dass er eine Art Freiheit darin erkennen kann, weniger Wahlmöglichkeiten zu haben. Oder handelt es sich um eine Art Simplizität, die Einfachheit eines Systems von Regeln und die Entscheidung, diese Regeln zu befolgen? Wir versuchen das Ganze auf einen größeren gesellschaftlichen Rahmen zu spannen: Was sind die Koordinaten für Glück? Muss es dabei um Individualität gehen oder kann eine kollektive Gesellschaft sogar glücklicher sein?
[...]
02.09.2022
Vor dem Training in Yokohama treffen wir Hiroyuki Yaguchi, einen der Gründerväter von »Shuudan Koudou«. Richard Siegal führt mit der Unterstützung von Kazumas Übersetzung ein Interview mit ihm. Er erzählt von den Anfängen der Disziplin und verortet dabei die Praxis des »Schuudan Koudou« klar in einer Tradition des Sports und weniger der Kunst. Sicherlich, so sagt er, sei sie nicht auf das Militär oder militärische Praxis zurückzuführen. Es handelt sich dabei mehr um eine Art Effizienzübung. Damals sei es in Student*innenkreisen entstanden. Mehrere Student*innen wohnten auf engem Raum zusammen und hätten nach einer Möglichkeit gesucht, ihren Alltag effizienter zu gestalten. Von diesem Gedanken ausgehend, hatten sie eine Praxis entwickelt, um Arbeit- und Bewegungsabläufe zu optimieren. Im Anschluss an das Interview findet das Training statt. Dem vorgestellt ist allerdings eine Aufführung des Ballett of Difference. Exzerpte aus MADE ALL WALKING/MADE TWO WALKING werden gezeigt. In einem direkt an das Showing anschließenden Gespräch, findet ein interessanter Austausch zwischen den in Deutschland beheimateten Tänzer*innen und den japanischen Student*innen statt. Diese zeigen sich ausgesprochen inspiriert von der präsentierten Tanz-Performance. Interessanterweise stellten die japanischen Student*innen vor allem Qualitäten wie Selbstbewusstsein und Individualität heraus, für die sie sich sehr begeistern können. Das Training, das auf dieses Gespräch folgt, hat nur noch einen vergleichsweise kleinen zeitlichen Raum. Trotzdem führte Mr. Omi eine neue, sehr schwierige Technik des »Shuudan Koudou« ein. Das sogenannte Crossing, in dessen Rahmen zwei Gruppen diagonal aufeinander zu gehen und sich ohne Berührung durchdringend passieren.
[...]
[...]
05.09.2022
Mister Omi ist sehr angespannt, weil wir erneut zu spät gekommen sind. Durch Kazumas nachträgliche Erläuterung wird uns die symbolische Tragweite dieses Verhaltens wirklich klar. Wieder wird kein Wort darüber verloren, doch die Stimmung ist schlecht und der Verstoß gegen die Codes der Höflichkeit liegt bleiern in der Luft. Bereits nach dem Aufwärmtraining bemängelt der Coach immer wieder scharf, dass viele Fehler gemacht würden. Die Ausdauer (geistig wie körperlich) würde nicht ausreichen. Die Schrittlängen seien falsch bemessen und die Arme würden unkontrolliert schwingen. Er sagt, er kenne diese Fehler genau. Er habe diese Fehler seit 30 Jahren beobachtet und analysiert. Früher sei es so gewesen, dass man über ein mehrere Stunden andauerndes Exerziertraining solche Fehler ausgemerzt habe. Man sei über Stunden ohne Pause marschiert bis alle Student*innen die Bewegungen verinnerlicht hätten. Mr. Omi lässt die Trainierenden immer wieder dieselbe Übung vollziehen und schaut bei den immer wiederkehrenden Kollisionen zu. Es gibt keine Einzelkorrekturen. Er ermahnt stattdessen die kollektive falsche Linienführung, bei der zu wenig Platz gelassen würde. (…)
Nach dem Training hält Mr. Omi eine lange Rede und lobt die graduellen Erfolge. Keiner habe geglaubt, dass es möglich sei. Aber am Ende seien die Aufgaben doch schaffbar gewesen. Auch wenn wir noch nicht ans Ziel angekommen seien. Nach dem Training entschuldigt sich Richard formell bei der Gruppe für unser Zuspätkommen. Mr. Omi wirkt sichtlich entspannt.
[...]
Nach dem Training hält Mr. Omi eine lange Rede und lobt die graduellen Erfolge. Keiner habe geglaubt, dass es möglich sei. Aber am Ende seien die Aufgaben doch schaffbar gewesen. Auch wenn wir noch nicht ans Ziel angekommen seien. Nach dem Training entschuldigt sich Richard formell bei der Gruppe für unser Zuspätkommen. Mr. Omi wirkt sichtlich entspannt.
[...]
07.09.2022
Zur nächsten Session in Yokohama wollen wir unbedingt pünktlich sein. Wir kommen über 40 Minuten vor Trainingsbeginn an. Die BOD-Tänzer*innen führen zu Beginn die Student*innen in die Probenpraxis von MADE ALL WALKING/MADE TWO WALKING ein. Gelernt wird in kleinen Gruppen, wobei je ein*e BOD-Tänzer*in circa fünf japanische Student*innen um sich schart, um Schritte und Bewegungen einzuüben. Die Student*innen haben viel Spaß, das Vokabular zu lernen, zeigen aber auch Unsicherheiten. In einem zweiten Schritt wird die Beinarbeit komplexer, schließlich werden Arm-Bewegungen und Händeklatschen integriert. Das stellt die Student*innen vor neue Herausforderungen. Die Koordination von Schritten und rhythmischen Armbewegungen scheint zu Beginn sehr schwierig, aber nach einiger Zeit werden erste Erfolge gezeitigt. Die japanischen Student*innen sind stolz und bringen das auch zum Ausdruck. Daraufhin beginnt das eigentliche »Shuudan-Koudou«-Training. Nach der Einheit spricht Mr. Omi darüber, in welchem Verhältnis Vertrauen und Unsicherheit während einer Performance gelagert werden sollten: Er spricht von 30 % Unsicherheit, die dazu führen soll, dass man weiter an sich arbeitet. 70 % Vertrauen kommen entsprechend auf der anderen Seite zu Stande. Andernfalls, also im Falle von 100 % Vertrauen, würde man aufhören, sich selbst verbessern zu wollen.
[...]
[...]
08.09.2022
In der Gruppe wird über die Probe vom Vortag reflektiert: Einige interessante Beobachtungen wurden gemacht. Etwa, als Richard Siegal eingangs die Studierenden dazu aufrief, sich eine*n Tänzer*in zu wählen, mit der*m sie in einer kleinen Gruppe arbeiten wollten, entgegneten die japanischen Student*innen mit verlegenen Gelächter. Offensichtlich gab es in der Aufforderung einen versteckten sexuellen Unterton, den Richard selbst nicht wahrgenommen hatte. Außerdem wurde eine Verwirrung offenbar, die vermeintlich mit der Autonomie, selbst zu wählen zu tun hatte. Eine individuelle Subjektivität, die im »Shuudan Koudou« normalerweise nicht vorgesehen ist. Unser Übersetzer Kazuma Glen erzählt, dass »Differenz« im japanischen dem Wort für »falsch« entspricht. Während »richtig« das Wort für »passen bzw. sich einfügen« sei. Wir erkennen, dass die Kompanie auch als »Fehlerhaftes Ballett« verstanden werden könnte.
14.09.2022
Franz Kafka: Ein Bericht für eine Akademie

Hohe Herren von der Akademie!
Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein äffisches Vorleben einzureichen.
In diesem Sinne kann ich leider der Aufforderung nicht nachkommen. Nahezu fünf Jahre trennen mich vom Affentum, eine Zeit, kurz vielleicht am Kalender gemessen, unendlich lang aber durchzugaloppieren, so wie ich es getan habe, streckenweise begleitet von vortrefflichen Menschen, Ratschlägen, Beifall und Orchestralmusik, aber im Grunde allein. Diese Leistung wäre unmöglich gewesen, wenn ich eigensinnig hätte an meinem Ursprung, an den Erinnerungen der Jugend festhalten wollen. Gerade Verzicht auf jeden Eigensinn war das oberste Gebot, das ich mir auferlegt hatte; ich, freier Affe, fügte mich diesem Joch.
Offen gesprochen, Ihr Affentum, meine Herren, sofern Sie etwas Derartiges hinter sich haben, kann Ihnen nicht ferner sein als mir das meine.
Das erste, was ich lernte, war: den Handschlag geben; Handschlag bezeigt Offenheit; mag nun heute, wo ich auf dem Höhepunkte meiner Laufbahn stehe, zu jenem ersten Handschlag auch das offene Wort hinzukommen.
Ich stamme von der Goldküste. Darüber, wie ich eingefangen wurde, bin ich auf fremde Berichte angewiesen. Eine Jagdexpedition — mit dem Führer habe ich übrigens seither schon manche gute Flasche Rotwein geleert — lag im Ufergebüsch auf dem Anstand, als ich am Abend inmitten eines Rudels zur Tränke lief. Man schoss; ich war der einzige, der getroffen wurde; ich bekam zwei Schüsse.
Einen in die Wange; der war leicht; hinterließ aber eine große ausrasierte rote Narbe, die mir den widerlichen, ganz und gar unzutreffenden Namen Rotpeter eingetragen hat.
Der zweite Schuss traf mich unterhalb der Hüfte. Er war schwer, er hat es verschuldet, dass ich noch heute ein wenig hinke. Letzthin las ich in einer Zeitung, meine Affennatur sei noch nicht ganz unterdrückt; Beweis dessen sei, dass ich, wenn Besucher kommen, mit Vorliebe die Hosen ausziehe, um die Einlaufstelle des Schusses zu zeigen. Alles liegt offen zutage; nichts ist zu verbergen; kommt es auf Wahrheit an, wirft jeder Großgesinnte die allerfeinsten Manieren ab.
Nach jenen Schüssen erwachte ich — und hier beginnt allmählich meine eigene Erinnerung — in einem Käfig im Zwischendeck eines Dampfers. Das Ganze war zu niedrig zum Aufrechtstehen und zu schmal zum Niedersitzen. Ich hockte deshalb mit eingebogenen, ewig zitternden Knien, im Dunkeln, während sich mir die Gitterstäbe ins Fleisch einschnitten. Man hält eine solche Verwahrung wilder Tiere in der allerersten Zeit für vorteilhaft, und ich kann heute nach meiner Erfahrung nicht leugnen, dass dies im menschlichen Sinn tatsächlich der Fall ist.
Daran dachte ich aber damals nicht. Ich war zum erstenmal in meinem Leben ohne Ausweg; Ich soll, wie man mir später sagte, ungewöhnlich wenig Lärm gemacht haben, woraus man schloss, dass ich entweder bald eingehen müsse oder dass ich, falls es mir gelingt, die erste kritische Zeit zu überleben, sehr dressurfähig sein werde. Ich überlebte diese Zeit. Dumpfes Schluchzen, schmerzhaftes Flöhesuchen, müdes Lecken einer Kokosnuss, Zungenblecken, wenn mir jemand nahekam — das waren die ersten Beschäftigungen in dem neuen Leben. In alledem aber doch nur das eine Gefühl: kein Ausweg. Ich kann natürlich das damals affenmäßig Gefühlte heute nur mit Menschenworten nachzeichnen.
Ich hatte doch so viele Auswege bisher gehabt und nun keinen mehr. Ich war festgerannt. Hätte man mich eingenagelt, meine Freizügigkeit wäre dadurch nicht kleiner geworden. Ich hatte keinen Ausweg, musste mir ihn aber verschaffen, denn ohne ihn konnte ich nicht leben. Immer an dieser Käfigwand — ich wäre verreckt. Aber Affen gehören an die Käfigwand — nun, so hörte ich auf, Affe zu sein.
Ein klarer, schöner Gedankengang, den ich irgendwie mit dem Bauch ausgeheckt haben muss, denn Affen denken mit dem Bauch.
Ich habe Angst, dass man nicht genau versteht, was ich unter Ausweg verstehe. Ich gebrauche das Wort in seinem gewöhnlichsten und vollsten Sinn. Ich sage absichtlich nicht Freiheit. Ich meine nicht dieses große Gefühl der Freiheit nach allen Seiten. Als Affe kannte ich es vielleicht und ich habe Menschen kennengelernt, die sich danach sehnen. Was mich aber anlangt, verlangte ich Freiheit weder damals noch heute. Nebenbei: mit Freiheit betrügt man sich unter Menschen allzuoft.
Und so wie die Freiheit zu den erhabensten Gefühlen zählt, so auch die entsprechende Täuschung zu den erhabensten. Nein, Freiheit wollte ich nicht. Nur einen Ausweg; rechts, links, wohin immer; ich stellte keine anderen Forderungen; Weiterkommen, weiterkommen!
Es sind gute Menschen, trotz allem. Wenn sie dienstfrei waren, setzten sich manchmal einige im Halbkreis um mich nieder und einer nahm einen Stecken und kitzelte mich dort, wo es mir angenehm war. Sollte ich heute eingeladen werden, eine Fahrt auf diesem Schiffe mitzumachen, ich würde die Einladung gewiss ablehnen, aber ebenso gewiß ist, dass es nicht nur hässliche Erinnerungen sind, denen ich dort im Zwischendeck nachhängen könnte.
Die Ruhe, die ich mir im Kreise dieser Leute erwarb, hielt mich vor allem von jedem Fluchtversuch ab. Ich weiß nicht mehr, ob Flucht möglich war, aber ich glaube es; einem Affen sollte Flucht immer möglich sein.
Ich sah diese Menschen auf und ab gehen, immer die gleichen Gesichter, die gleichen Bewegungen, oft schien es mir, als wäre es nur einer. Ein hohes Ziel dämmerte mir auf. Niemand versprach mir, dass, wenn ich so wie sie werden würde, das Gitter aufgezogen werde.
Aber es war so leicht, die Leute nachzuahmen. Spucken konnte ich schon in den ersten Tagen. Wir spuckten einander gegenseitig ins Gesicht; der Unterschied war nur, dass ich mein Gesicht nachher rein leckte, sie ihres nicht. Die Pfeife rauchte ich bald wie ein Alter;
Die meiste Mühe machte mir die Schnapsflasche. Der Geruch peinigte mich; ich zwang mich mit allen Kräften; aber es vergingen Wochen, ehe ich mich überwand.
Was für ein Sieg dann allerdings, als ich eines Abends vor großem Zuschauerkreis eine vor meinem Käfig stehengelassene Schnapsflasche ergriff, sie schulgerecht entkorkte, an den Mund setzte und ohne Zögern, ohne Mundverziehen, als Trinker vom Fach, mit rund gewälzten Augen, wirklich und wahrhaftig leer trank; nicht mehr als Verzweifelter, sondern als Künstler die Flasche hinwarf; dafür aber, kurz und gut »Hallo!« ausrief, in Menschenlaut ausbrach, mit diesem Ruf in die Menschengemeinschaft sprang und ihr Echo: »Hört nur, er spricht!« wie einen Kuss auf meinem Körper fühlte.
Ich wiederhole: es verlockte mich nicht, die Menschen nachzuahmen; ich ahmte nach, weil ich einen Ausweg suchte, aus keinem anderen Grund.
Als ich in Hamburg dem ersten Dresseur übergeben wurde, erkannte ich bald die zwei Möglichkeiten, die mir offenstanden: Zoologischer Garten oder Varieté. Ich zögerte nicht. Ich sagte mir: setze alle Kraft an, um ins Varieté zu kommen; das ist der Ausweg;
Und ich lernte, meine Herren. Ach, man lernt, wenn man muss; man lernt, wenn man einen Ausweg will; man lernt rücksichtslos. Man beaufsichtigt sich selbst mit der Peitsche; man zerfleischt sich beim geringsten Widerstand.
Diese Fortschritte! Dieses Eindringen der Wissensstrahlen von allen Seiten ins erwachende Hirn! Ich leugne nicht: es beglückte mich. Ich gestehe aber auch ein: ich überschätzte es nicht, schon damals nicht, wieviel weniger heute. Das wäre an sich vielleicht gar nichts, ist aber insofern doch etwas, als es mir aus dem Käfig half und mir diesen Menschenausweg verschaffte.
Überblicke ich meine Entwicklung und ihr bisheriges Ziel, so klage ich weder, noch bin ich zufrieden. Die Hände in den Hosentaschen, die Weinflasche auf dem Tisch, liege ich halb, halb sitze ich im Schaukelstuhl und schaue aus dem Fenster. Kommt Besuch, empfange ich ihn, wie es sich gebührt. Mein Impresario sitzt im Vorzimmer; läute ich, kommt er und hört, was ich zu sagen habe. Am Abend ist fast immer Vorstellung, und ich habe wohl kaum mehr zu steigernde Erfolge. Komme ich spät nachts von Banketten, aus wissenschaftlichen Gesellschaften, aus gemütlichem Beisammensein nach Hause, erwartet mich eine kleiner halbdressierter Schimpansin und ich lasse es mir nach Affenart bei ihr wohlgehen. Bei Tag will ich sie nicht sehen; sie hat nämlich den Irrsinn des verwirrten dressierten Tieres im Blick; das erkenne nur ich, und ich kann es nicht ertragen. Im ganzen habe ich jedenfalls erreicht, was ich erreichen wollte. Man sage nicht, es wäre der Mühe nicht wert gewesen. Im übrigen will ich keines Menschen Urteil, ich will nur Kenntnisse verbreiten, ich berichte nur, auch Ihnen, hohe Herren von der Akademie, habe ich nur berichtet.
Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein äffisches Vorleben einzureichen.
In diesem Sinne kann ich leider der Aufforderung nicht nachkommen. Nahezu fünf Jahre trennen mich vom Affentum, eine Zeit, kurz vielleicht am Kalender gemessen, unendlich lang aber durchzugaloppieren, so wie ich es getan habe, streckenweise begleitet von vortrefflichen Menschen, Ratschlägen, Beifall und Orchestralmusik, aber im Grunde allein. Diese Leistung wäre unmöglich gewesen, wenn ich eigensinnig hätte an meinem Ursprung, an den Erinnerungen der Jugend festhalten wollen. Gerade Verzicht auf jeden Eigensinn war das oberste Gebot, das ich mir auferlegt hatte; ich, freier Affe, fügte mich diesem Joch.
Offen gesprochen, Ihr Affentum, meine Herren, sofern Sie etwas Derartiges hinter sich haben, kann Ihnen nicht ferner sein als mir das meine.
Das erste, was ich lernte, war: den Handschlag geben; Handschlag bezeigt Offenheit; mag nun heute, wo ich auf dem Höhepunkte meiner Laufbahn stehe, zu jenem ersten Handschlag auch das offene Wort hinzukommen.
Ich stamme von der Goldküste. Darüber, wie ich eingefangen wurde, bin ich auf fremde Berichte angewiesen. Eine Jagdexpedition — mit dem Führer habe ich übrigens seither schon manche gute Flasche Rotwein geleert — lag im Ufergebüsch auf dem Anstand, als ich am Abend inmitten eines Rudels zur Tränke lief. Man schoss; ich war der einzige, der getroffen wurde; ich bekam zwei Schüsse.
Einen in die Wange; der war leicht; hinterließ aber eine große ausrasierte rote Narbe, die mir den widerlichen, ganz und gar unzutreffenden Namen Rotpeter eingetragen hat.
Der zweite Schuss traf mich unterhalb der Hüfte. Er war schwer, er hat es verschuldet, dass ich noch heute ein wenig hinke. Letzthin las ich in einer Zeitung, meine Affennatur sei noch nicht ganz unterdrückt; Beweis dessen sei, dass ich, wenn Besucher kommen, mit Vorliebe die Hosen ausziehe, um die Einlaufstelle des Schusses zu zeigen. Alles liegt offen zutage; nichts ist zu verbergen; kommt es auf Wahrheit an, wirft jeder Großgesinnte die allerfeinsten Manieren ab.
Nach jenen Schüssen erwachte ich — und hier beginnt allmählich meine eigene Erinnerung — in einem Käfig im Zwischendeck eines Dampfers. Das Ganze war zu niedrig zum Aufrechtstehen und zu schmal zum Niedersitzen. Ich hockte deshalb mit eingebogenen, ewig zitternden Knien, im Dunkeln, während sich mir die Gitterstäbe ins Fleisch einschnitten. Man hält eine solche Verwahrung wilder Tiere in der allerersten Zeit für vorteilhaft, und ich kann heute nach meiner Erfahrung nicht leugnen, dass dies im menschlichen Sinn tatsächlich der Fall ist.
Daran dachte ich aber damals nicht. Ich war zum erstenmal in meinem Leben ohne Ausweg; Ich soll, wie man mir später sagte, ungewöhnlich wenig Lärm gemacht haben, woraus man schloss, dass ich entweder bald eingehen müsse oder dass ich, falls es mir gelingt, die erste kritische Zeit zu überleben, sehr dressurfähig sein werde. Ich überlebte diese Zeit. Dumpfes Schluchzen, schmerzhaftes Flöhesuchen, müdes Lecken einer Kokosnuss, Zungenblecken, wenn mir jemand nahekam — das waren die ersten Beschäftigungen in dem neuen Leben. In alledem aber doch nur das eine Gefühl: kein Ausweg. Ich kann natürlich das damals affenmäßig Gefühlte heute nur mit Menschenworten nachzeichnen.
Ich hatte doch so viele Auswege bisher gehabt und nun keinen mehr. Ich war festgerannt. Hätte man mich eingenagelt, meine Freizügigkeit wäre dadurch nicht kleiner geworden. Ich hatte keinen Ausweg, musste mir ihn aber verschaffen, denn ohne ihn konnte ich nicht leben. Immer an dieser Käfigwand — ich wäre verreckt. Aber Affen gehören an die Käfigwand — nun, so hörte ich auf, Affe zu sein.
Ein klarer, schöner Gedankengang, den ich irgendwie mit dem Bauch ausgeheckt haben muss, denn Affen denken mit dem Bauch.
Ich habe Angst, dass man nicht genau versteht, was ich unter Ausweg verstehe. Ich gebrauche das Wort in seinem gewöhnlichsten und vollsten Sinn. Ich sage absichtlich nicht Freiheit. Ich meine nicht dieses große Gefühl der Freiheit nach allen Seiten. Als Affe kannte ich es vielleicht und ich habe Menschen kennengelernt, die sich danach sehnen. Was mich aber anlangt, verlangte ich Freiheit weder damals noch heute. Nebenbei: mit Freiheit betrügt man sich unter Menschen allzuoft.
Und so wie die Freiheit zu den erhabensten Gefühlen zählt, so auch die entsprechende Täuschung zu den erhabensten. Nein, Freiheit wollte ich nicht. Nur einen Ausweg; rechts, links, wohin immer; ich stellte keine anderen Forderungen; Weiterkommen, weiterkommen!
Es sind gute Menschen, trotz allem. Wenn sie dienstfrei waren, setzten sich manchmal einige im Halbkreis um mich nieder und einer nahm einen Stecken und kitzelte mich dort, wo es mir angenehm war. Sollte ich heute eingeladen werden, eine Fahrt auf diesem Schiffe mitzumachen, ich würde die Einladung gewiss ablehnen, aber ebenso gewiß ist, dass es nicht nur hässliche Erinnerungen sind, denen ich dort im Zwischendeck nachhängen könnte.
Die Ruhe, die ich mir im Kreise dieser Leute erwarb, hielt mich vor allem von jedem Fluchtversuch ab. Ich weiß nicht mehr, ob Flucht möglich war, aber ich glaube es; einem Affen sollte Flucht immer möglich sein.
Ich sah diese Menschen auf und ab gehen, immer die gleichen Gesichter, die gleichen Bewegungen, oft schien es mir, als wäre es nur einer. Ein hohes Ziel dämmerte mir auf. Niemand versprach mir, dass, wenn ich so wie sie werden würde, das Gitter aufgezogen werde.
Aber es war so leicht, die Leute nachzuahmen. Spucken konnte ich schon in den ersten Tagen. Wir spuckten einander gegenseitig ins Gesicht; der Unterschied war nur, dass ich mein Gesicht nachher rein leckte, sie ihres nicht. Die Pfeife rauchte ich bald wie ein Alter;
Die meiste Mühe machte mir die Schnapsflasche. Der Geruch peinigte mich; ich zwang mich mit allen Kräften; aber es vergingen Wochen, ehe ich mich überwand.
Was für ein Sieg dann allerdings, als ich eines Abends vor großem Zuschauerkreis eine vor meinem Käfig stehengelassene Schnapsflasche ergriff, sie schulgerecht entkorkte, an den Mund setzte und ohne Zögern, ohne Mundverziehen, als Trinker vom Fach, mit rund gewälzten Augen, wirklich und wahrhaftig leer trank; nicht mehr als Verzweifelter, sondern als Künstler die Flasche hinwarf; dafür aber, kurz und gut »Hallo!« ausrief, in Menschenlaut ausbrach, mit diesem Ruf in die Menschengemeinschaft sprang und ihr Echo: »Hört nur, er spricht!« wie einen Kuss auf meinem Körper fühlte.
Ich wiederhole: es verlockte mich nicht, die Menschen nachzuahmen; ich ahmte nach, weil ich einen Ausweg suchte, aus keinem anderen Grund.
Als ich in Hamburg dem ersten Dresseur übergeben wurde, erkannte ich bald die zwei Möglichkeiten, die mir offenstanden: Zoologischer Garten oder Varieté. Ich zögerte nicht. Ich sagte mir: setze alle Kraft an, um ins Varieté zu kommen; das ist der Ausweg;
Und ich lernte, meine Herren. Ach, man lernt, wenn man muss; man lernt, wenn man einen Ausweg will; man lernt rücksichtslos. Man beaufsichtigt sich selbst mit der Peitsche; man zerfleischt sich beim geringsten Widerstand.
Diese Fortschritte! Dieses Eindringen der Wissensstrahlen von allen Seiten ins erwachende Hirn! Ich leugne nicht: es beglückte mich. Ich gestehe aber auch ein: ich überschätzte es nicht, schon damals nicht, wieviel weniger heute. Das wäre an sich vielleicht gar nichts, ist aber insofern doch etwas, als es mir aus dem Käfig half und mir diesen Menschenausweg verschaffte.
Überblicke ich meine Entwicklung und ihr bisheriges Ziel, so klage ich weder, noch bin ich zufrieden. Die Hände in den Hosentaschen, die Weinflasche auf dem Tisch, liege ich halb, halb sitze ich im Schaukelstuhl und schaue aus dem Fenster. Kommt Besuch, empfange ich ihn, wie es sich gebührt. Mein Impresario sitzt im Vorzimmer; läute ich, kommt er und hört, was ich zu sagen habe. Am Abend ist fast immer Vorstellung, und ich habe wohl kaum mehr zu steigernde Erfolge. Komme ich spät nachts von Banketten, aus wissenschaftlichen Gesellschaften, aus gemütlichem Beisammensein nach Hause, erwartet mich eine kleiner halbdressierter Schimpansin und ich lasse es mir nach Affenart bei ihr wohlgehen. Bei Tag will ich sie nicht sehen; sie hat nämlich den Irrsinn des verwirrten dressierten Tieres im Blick; das erkenne nur ich, und ich kann es nicht ertragen. Im ganzen habe ich jedenfalls erreicht, was ich erreichen wollte. Man sage nicht, es wäre der Mühe nicht wert gewesen. Im übrigen will ich keines Menschen Urteil, ich will nur Kenntnisse verbreiten, ich berichte nur, auch Ihnen, hohe Herren von der Akademie, habe ich nur berichtet.
VIDEO INTERVIEW mit RICHARD SIEGAL
Interview mit Richard Siegal (Text)
Das Potenzial, sich in Menschenmengen zu organisieren
Der Choreograf Richard Siegal im Gespräch mit dem Dramaturgen Tobias Staab

Thomas Schermer
Tobias Staab: Weißt Du noch, wie Du das erste Mal mit »Shuudan Koudou«, dem Japanese Precision Walking, in Kontakt kamst?
Richard Siegal: Vielleicht 2010 oder 2011... Ich hatte schon eine Weile darüber nachgedacht, als ich das Stück UNITXT machte, das 2013 am Bayerischen Staatsballett uraufgeführt wurde.
Tobias Staab: Und Du hattest das im Internet entdeckt?
Richard Siegal: Ich denke schon, ja. Es war eine Art Meme, das sich viral im Netz verbreitete. Ich wurde richtig besessen davon. Ich hatte die Idee, mit dieser Praxis zu arbeiten, als du und ich 2014 anfingen zusammenzuarbeiten im Rahmen der Ruhrtriennale. Meine Idee war, die japanischen Precision Walker hierher nach Deutschland zu bringen, um mit ihnen eine Arbeit in der Kraftzentrale in Duisburg zu realisieren. Das hat nicht geklappt, aber der Gedanke, direkt mit ihnen zu arbeiten, hat mich nie losgelassen. Daraus entwickelte sich schließlich die Idee, dass wir stattdessen nach Japan fahren und einen kulturellen Austausch mit ihnen lancieren. Von dort wollten wir zurückkommen und eine Aufführung machen, die auf unseren Erfahrungen und dem erworbenen Wissen basiert.
Tobias Staab: Was haben Du und die Tänzer*innen in Japan gelernt?
Richard Siegal: Wir haben gelernt, wie man marschiert (lacht). Und vielleicht auch, wie man als Gruppe funktioniert und wie man sich verhält, um eine Einheit zu werden. Sich ganz der Form zu unterwerfen, unter dem Kriterium, so identisch wie möglich sein zu wollen. Denn das ist es, was diese Form verlangt.
Tobias Staab: Wie würdest Du den Lernprozess beschreiben?
Richard Siegal: Ich denke, das hängt davon ab, was man unter Lernen versteht. Was ist »Shuudan Koudou« wirklich? Es ist eine Form. Wir haben also mit den japanischen Student*innen an der Sports University in Yokohama trainiert, was bedeutete, dass wir als Gruppe synchron gingen und verschiedene Manöver und Kommandos lernten, die wir dann gemeinsam als Gruppe übten. Dann wurden wir von Mr. Omi (dem Trainer der Student*innen) korrigiert. Auch außerhalb des gemeinsamen Trainings an der Universität übten wir jeden Tag weiter, um uns die Fähigkeiten anzueignen und darin immer präziser zu werden. Aber vielleicht war das, was wir wirklich beim »Shuudan Koudou« lernten, eher ein Esprit oder eine Einstellung.
Tobias Staab: Eine Philosophie?
Richard Siegal: Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Philosophie ist, aber warum nicht?
Tobias Staab: Lässt sich die Praxis von einer Philosophie ableiten?
Richard Siegal: Das ist so eine Art Huhn-und-Ei-Frage, nicht wahr? Warum verhalten wir uns so? Warum haben die Menschen eine Art des Zusammenseins wie das »Shuudan Koudou« entwickelt, wenn sie nicht aus einer Art philosophischer Überzeugung heraus entstanden ist.
Tobias Staab: Aber wie würdest Du diese Überzeugung definieren?
Richard Siegal: In unseren Interviews mit Herrn Yaguchi, einem der Gründerväter des »Shuudan Koudou«, wurde klar, dass es aus Sicherheitsübungen hervorgegangen sei. Und dass es aus dem Bedürfnis heraus entstanden sei, in einem dicht besiedelten Gebiet auf eine sichere und effiziente Weise zusammenzuleben. Die Kinder werden also von klein auf in der Schule zu dieser Form des Verhaltens, erzogen. Das ist ein Sozialisierungsprozess. Man kann sich nicht vorstellen, dass »Shuudan Koudou« in einem australischen Ureinwohnerstamm praktiziert werden würde, denn es gibt dort einfach zu viel Platz und nicht genug Menschen, als dass man jemals auf die Idee kommen würde, dass man von dieser Praxis profitieren könnte. Es handelt sich um eine Reaktion auf unsere überfüllte Umwelt.
Tobias Staab: Wie verhält es sich mit der militärischen Konnotation?
Richard Siegal: Das ist nur ein Aspekt, den man mit diesem Potenzial umsetzen kann – dass Menschen in der Lage sein müssen, sich in Menschenmengen zu organisieren. Das kann sehr effektiv genutzt werden, um Krieg zu führen. Ich denke, die Römer*innen waren wahrscheinlich die ersten oder vielleicht die fortschrittlichsten, die diese Idee des kollektiven Handelns in der Kriegsführung nutzten. Aber es ist nicht nur das. Es ist auch ein ästhetisches Phänomen, und es ist wirklich wundervoll, dem zuzusehen. »Shuudan Koudou« beinhaltet eine Schönheit und trägt eine positive Gruppenmoral in sich. Aber gleichzeitig ist auch überhaupt nichts, was so viel bedeutet wie, dass es nur für sich selbst existiert, als etwas, das keine Konnotation hat.
Tobias Staab: Worin besteht die Dimension der Moral, von der Du sprichst?
Richard Siegal: Das Gefühl des Wohlbefindens, das ein Individuum über sich selbst innerhalb eines Zusammenseins haben kann. Das entsteht dabei. Es ist so ähnlich wie beim gemeinsamen Singen oder Trommeln. Man bringt die Körper zusammen, extrem synchronisiert, und dann kommen alle zusammen. Das schafft Harmonie.
Tobias Staab: Vielleicht liegt es an der deutschen Geschichte und dem sozialen Kontext, in dem ich aufgewachsen bin... aber für mich scheint der militärische Aspekt dominanter zu sein als nur eine mögliche Assoziation unter anderen. Ich kann nicht aufhören, über die Gefahren nachzudenken, die in dem, was Du als Moral bezeichnest, impliziert sind. Ich meine die Vorstellung, dass man seine eigene Individualität aufgibt, um mit einer Gruppe eins zu werden und dadurch sein kritisches Potenzial zu verlieren …
Richard Siegal: Du sagst, dass es vielleicht daran liegt, dass Du Deutscher bist?
Tobias Staab: Ja, ich hatte von klein auf eine Skepsis gegenüber all diesen Formen des Miteinanders...
Richard Siegal: Aber das ändert sich doch, oder? Die deutsche Regierung steckt derzeit Milliarden von Dollar in den Verteidigungshaushalt, und ich denke, dass sich die Einstellung der Menschen zum militärischen Verhalten, zur Verteidigung und zum Patriotismus in Deutschland in den kommenden Generationen definitiv ändern wird... Auch in Japan. Die Menschen dort werden sehr stark zum Pazifismus erzogen, auch wenn die Gesellschaft dort viel stärker formalisiert zu sein scheint, als in Deutschland. Wenngleich die Menschen in Deutschland sich wirklich viel kollektiver verhalten, als in anderen Ländern.
Tobias Staab: Ist das so?
Richard Siegal: Ja, sicher. Als ich 1997 zum ersten Mal nach Frankfurt zog, war ich schockiert, dass mich die Leute zurechtwiesen, wenn ich die Regeln brach. Wenn ich zum Beispiel bei Rot über die Ampel ging, selbst wenn keine Autos da waren. Oder dass die U-Bahnen hier auf Ehrlichkeit basieren – man wird kaum kontrolliert, während es in anderen Gesellschaften wie New York, wo ich herkam, riesige Schranken gibt, so dass es sehr schwierig wird, in die U-Bahn zu kommen, ohne zu bezahlen. Ich denke, dass diese Dinge sehr bezeichnend für einen allgemeinen Zusammenhalt in der Gesellschaft sind.
Tobias Staab: Eine der Fragen, die wir uns auf unserer Forschungsreise nach Japan stellten, war die nach den Unterschieden zwischen Gesellschaften, die individuell strukturiert sind, und Gesellschaften, die auf einem eher kollektiven Denken aufbauen...
Richard Siegal: Ja, es geht um eine Kollision zwischen den hyperindividualistischen Gesellschaften Westeuropas und Nordamerikas, die mit dieser anderen, ultraautoritären Art des Zusammenlebens koexistieren müssen.
Tobias Staab: Was kannst Du über den Titel BALLET OF (DIS)OBEDIENCE sagen – was ist ein Ballett des Ungehorsams?
Richard Siegal: Der ursprüngliche Titel war »Ballet of Obedience«, aber dann wurde es umbenannt in BALLET OF (DIS)OBEDIENCE. Ich hätte auch gerne einen zweiten Titel oder Untertitel, der lautet: »Theater of No«.
Tobias Staab: Worauf bezieht sich das?
Richard Siegal: Auf das japanische »Noh-Theater«, vor allem im Kontext eines Stück von Yukio Mishima, das wir ursprünglich geplant hatten, zu verwenden. Und natürlich auf den Ungehorsam.
Tobias Staab: Verwendest Du auch formale Aspekte des »Noh-Theaters«?
Richard Siegal: Ich habe es wirklich genossen, das »Noh-Theater« in Tokio zu sehen. Aber was ist »Noh-Theater«? Es ist die Form des Textes der Stücke, die immer der gleichen Formel folgen, indem sie von der Realität des Stückes in eine Art Traumsequenz fallen. Im »Noh-Theater« sind die Bühne im Raum und das Spiel extrem formalisiert. In unserem Fall gibt es bestenfalls eine Abstraktion davon. Meine Bühne ist eher vom Boden der Turnhalle inspiriert, an der Sportuniversität in Yokohama, wo wir »Shuudan Koudou« zusammen mit den japanischen Student*innen geprobt haben. Der Holzboden dort ist überzogen von aufgemalten Linien für die sportlichen Aktivitäten, die dort stattfanden. Die Lackschichten sind seit den 70er Jahren am abblättern. Das war zudem ein extrem resonanzfähiger Raum, so dass die Schritte der Schüler und ihre Stimmen im Raum sehr lange nachhallten. Dadurch entstand dieses bassige Dröhnen der Schritte beim Marschieren. In den mittleren Frequenzen waren Stimmen die hören und im oberen Frequenzbereich gab es diese Quietschgeräusche, die herauskommen, wenn die Gruppe um die Ecke biegt. Dabei entstand eine wunderbare Musik. Ich hoffe diese Elemente werden auch im Stück zu hören sein.
Tobias Staab: Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der Pina-Bausch-Tänzerin Nazareth Panadero?
Richard Siegal: Bettina Wagner-Bergelt hatte mich 2018 gebeten, ein Projekt mit den Tänzer*innen der Pina Bausch Company zu machen. Und ich habe mich für eine Gruppe von älteren Tänzer*innen entschieden, die mit Pina Bausch zusammengearbeitet hatten. Nazareth war eine von ihnen. Sie kamen nach Madrid und wir arbeiteten etwa eine Woche lang zusammen, um dann nach Wuppertal zu gehen und dort einige Tage zu verbringen. Wir haben uns wirklich gut verstanden, aber dann kam die Pandemie. Das Material, das wir in diesen zwei Wochen gemacht hatten, wurde auf Eis gelegt und wir wussten nicht, was wir damit machen sollten. Nazareth hatte dabei wirklich interessantes Bewegungsmaterial produziert und mir Videos davon geschickt. Noch vor dem Lockdowns hatten wir einige Szenen entwickelt.
Tobias Staab: Habt Ihr auch mit Text gearbeitet?
Richard Siegal: Ja, mit Sprache, mit Texten. Es gab sogar einen Song. Alles hatte mit dem Trauerprozess zu tun, mit den verschiedenen emotionalen Stadien, die man durchläuft. Das rührte von meinem Interesse her, an Pinas Tod einerseits und andererseits an dem Zustand, in dem ich die Kompanie vorfand. Es war offensichtlich, dass es in den letzten zehn Jahren nach ihrem Tod eine Menge Aufruhr gab. Es herrschte große Verwirrung, Wut und Frustration. Ein angemessener Trauerprozess war nie gemeinsam durchlaufen worden. Es ging also um den Tod. Dann wollte ich, dass sie in ECTOPIA mitspielen sollte, aber es stellte sich leider heraus, dass sie einen Terminkonflikt hatte. Schließlich habe ich Nazareth für dieses Projekt gefragt, ob sie die Rolle übernehmen wollte, und sie willigte ein – obwohl sie keine Schauspielerin sei, es zu versuchen.
Tobias Staab: Kannst Du bitte etwas über die Texte erzählen, die in BALLET OF (DIS)OBEDIENCE vorkommen, und wie sie mit der Praxis von »Shuudan Koudou« zusammenhängen?
Richard Siegal: Wir begannen eigentlich mit einem Text von Yukio Mishima aus einer Sammlung von Stücken mit dem Titel FIVE MODERN NOH PLAYS. Wir haben das erste Stück, SOTOBA KOMACHI, verwendet. Diesen Text habe ich größtenteils in einen Monolog für Nazareth umgeschrieben, aber im Stück selbst ist es ein Dialog mit einem Dichter. Die Rolle des Dichters wurde implizit zu der des Publikums, an das sie sich wendet. Es gab auch eine lange Passage, in der die Tänzer*innen Rollen von verschiedenen Figuren übernahmen. Das war eine Traumsequenz, in der es eine Art Besessenheit, eine Übertragung, gab, die von den Tänzer*innen dargestellt werden sollte. Der Text ist insofern sehr interessant, als er der Form des alten »Nōh-Theaters« folgt.
Mishimas Text spiegelt nach meinem Verständnis bestimmte Themen über die Verwestlichung oder die Kontamination der – in Anführungszeichen – »reinen japanischen Kultur« wider. Der Text ist also ein Ausdruck von Mishimas Anliegen als Künstler, als Bürger, als Nationalist, eine verlorene nationale Identität zu bewahren. Aber das ist natürlich nicht alles in diesem Stück. Es gibt dort auch sehr starke Themen wie Tod und Verfall, Schönheit und Hässlichkeit... All diese Dinge wurden in Beziehung zum »Shuudan Koudou« gesetzt. Dabei entstanden Muster und Assoziationen zu militärischem Verhalten, nationaler Identität, bestimmten Arten anorganischer Organisation, Geometrie... die Beziehung zwischen diesen Elementen war sehr komplex.
Aber da wir die Rechte an diesem Text nicht bekommen haben, sind wir auf einen Text von Franz Kafka ausgewichen –EIN BERICHT AN EINE AKADEMIE. Es handelt sich um den Monolog eines Affen in Gefangenschaft, der an der Goldküste Afrikas gefangen genommen und in einem Transportkäfig nach Europa gebracht wurde. Um aus seiner Gefangenschaft zu entkommen lernt der Affe, das Verhalten jener Menschen nachzuahmen, die ihn gefangen genommen haben. Er wird zu einem eifrigen Schüler und lernt, Hände zu schütteln, zu rauchen, zu trinken und zu sprechen. Er ahmt die Menschen so gut nach, dass er immer mehr zu einem Mitglied der Gesellschaft wird. Ein gefeierter Bürger, der seine Geschichte einem internationalen Publikum erzählt. Die Beziehung zwischen diesem Text und dem »Shuudan Koudou«verändert naturgemäß die Bedeutung des »Shuudan Koudou« gegenüber dem Mishima-Text. Da der Kafka-Text so viel mehr und auf direktere Weise mit Sozialisation zu tun hat, überschneidet er sich in gewisser Weise weniger schräg mit dem Thema, das der »Shuudan Koudou« anspricht.
Tobias Staab: Worin liegen dabei die Herausforderungen für die Tänzer*innen?
Richard Siegal: Nun, die Tänzer*innen sind keine ausgebildeten Schauspieler*innen. Sie sind sich der Techniken und Konventionen des Schauspiels nicht bewusst und das stellt also eine Herausforderung für sie dar. Man erhält dabei eine Form des Spiels, die sich kategorisch vom Schauspiel unterscheidet. Wenn jemand wie Martina Chavez oder Nico Martínez auf der Bühne mit einer sehr natürlichen Präsenz spricht und ein Gefühl für Timing, Musikalität und Authentizität hat, hat das etwas Würdiges und Betörendes. Solange wir uns bewusst sind, dass wir nicht versuchen, wirklich in die Geschichte des Sprechtheaters einzutreten, können wir zuversichtlich sein, dass wir etwas zu sagen haben.
Tobias Staab: Warum ist es Dir überhaupt wichtig, mit einem Narrativ zu arbeiten?
Richard Siegal: Ich denke, es ist ein guter Moment für die Company, sich einer Erzählung im konventionelleren Sinne von Storytelling oder Charakterentwicklung zu widmen, denn das haben wir in all den Jahren nicht wirklich getan, obwohl wir dies gewissermaßen zu unserer Mission erklärt hatten: Neue Erzählungen zu schaffen, die mehr mit der Zeit, in der wir leben, übereinstimmen.
Bei unserem Debütabend im Jahr 2017 hieß eines der Stücke EXCERPTS OF A FUTURE BALLET IN THE SUBJECT OF CHELSEA MANNING. Ich hatte also bereits das Fundament gelegt, auf dem wir ein abendfüllendes Handlungsballett machen könnten, das die Geschichte von Chelsea Manning erzählt – was wir aber noch nicht getan haben.
Aber der Katalysator für diesen Kurswechsel war sicherlich die Einladung von Hein Mulders, Intendant der Oper Köln, in dieser Spielzeit eine PETRUSCHKA zu machen, durch die ich aufs Neue mit der Idee einer Erzählung konfrontiert wurde. Für uns geht es nicht unbedingt darum, neue Erzählungen zu schaffen, sondern auch darum, bestehende Narrative neu zu erzählen. Das kann sogar ein bereits existierendes Stück Literatur oder ein Handlungsballett sein, vorausgesetzt, wir vermeiden dabei, überholte Werte und Moralvorstellungen in unsere Gegenwart und Zukunft zu schleppen. Es ist wichtig, die Relevanz dieser Geschichten zu bewahren. Ich denke, es ist auch generell eine gute Zeit, um Narrativen den Weg zurück in den zeitgenössischen Tanz zu ebnen. Es gibt schließlich einige Dinge, die nicht durch Abstraktion gesagt werden können – so wie es einige Dinge gibt, die nicht durch eine Erzählung vermittelt werden können. Dabei geht es vor allem um Geschichten, die auf der Bühne erzählt werden können, und die im Moment besonders wichtig zu hören sind. Geschichten über Nationalismus. Geschichten über die Natur des Todes und des Sterbens und des Verfalls, oder auch Geschichten über Kontrolle und Machtstrukturen, wie sie vielleicht in PETRUSCHKA thematisiert wurden.
Richard Siegal: Vielleicht 2010 oder 2011... Ich hatte schon eine Weile darüber nachgedacht, als ich das Stück UNITXT machte, das 2013 am Bayerischen Staatsballett uraufgeführt wurde.
Tobias Staab: Und Du hattest das im Internet entdeckt?
Richard Siegal: Ich denke schon, ja. Es war eine Art Meme, das sich viral im Netz verbreitete. Ich wurde richtig besessen davon. Ich hatte die Idee, mit dieser Praxis zu arbeiten, als du und ich 2014 anfingen zusammenzuarbeiten im Rahmen der Ruhrtriennale. Meine Idee war, die japanischen Precision Walker hierher nach Deutschland zu bringen, um mit ihnen eine Arbeit in der Kraftzentrale in Duisburg zu realisieren. Das hat nicht geklappt, aber der Gedanke, direkt mit ihnen zu arbeiten, hat mich nie losgelassen. Daraus entwickelte sich schließlich die Idee, dass wir stattdessen nach Japan fahren und einen kulturellen Austausch mit ihnen lancieren. Von dort wollten wir zurückkommen und eine Aufführung machen, die auf unseren Erfahrungen und dem erworbenen Wissen basiert.
Tobias Staab: Was haben Du und die Tänzer*innen in Japan gelernt?
Richard Siegal: Wir haben gelernt, wie man marschiert (lacht). Und vielleicht auch, wie man als Gruppe funktioniert und wie man sich verhält, um eine Einheit zu werden. Sich ganz der Form zu unterwerfen, unter dem Kriterium, so identisch wie möglich sein zu wollen. Denn das ist es, was diese Form verlangt.
Tobias Staab: Wie würdest Du den Lernprozess beschreiben?
Richard Siegal: Ich denke, das hängt davon ab, was man unter Lernen versteht. Was ist »Shuudan Koudou« wirklich? Es ist eine Form. Wir haben also mit den japanischen Student*innen an der Sports University in Yokohama trainiert, was bedeutete, dass wir als Gruppe synchron gingen und verschiedene Manöver und Kommandos lernten, die wir dann gemeinsam als Gruppe übten. Dann wurden wir von Mr. Omi (dem Trainer der Student*innen) korrigiert. Auch außerhalb des gemeinsamen Trainings an der Universität übten wir jeden Tag weiter, um uns die Fähigkeiten anzueignen und darin immer präziser zu werden. Aber vielleicht war das, was wir wirklich beim »Shuudan Koudou« lernten, eher ein Esprit oder eine Einstellung.
Tobias Staab: Eine Philosophie?
Richard Siegal: Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Philosophie ist, aber warum nicht?
Tobias Staab: Lässt sich die Praxis von einer Philosophie ableiten?
Richard Siegal: Das ist so eine Art Huhn-und-Ei-Frage, nicht wahr? Warum verhalten wir uns so? Warum haben die Menschen eine Art des Zusammenseins wie das »Shuudan Koudou« entwickelt, wenn sie nicht aus einer Art philosophischer Überzeugung heraus entstanden ist.
Tobias Staab: Aber wie würdest Du diese Überzeugung definieren?
Richard Siegal: In unseren Interviews mit Herrn Yaguchi, einem der Gründerväter des »Shuudan Koudou«, wurde klar, dass es aus Sicherheitsübungen hervorgegangen sei. Und dass es aus dem Bedürfnis heraus entstanden sei, in einem dicht besiedelten Gebiet auf eine sichere und effiziente Weise zusammenzuleben. Die Kinder werden also von klein auf in der Schule zu dieser Form des Verhaltens, erzogen. Das ist ein Sozialisierungsprozess. Man kann sich nicht vorstellen, dass »Shuudan Koudou« in einem australischen Ureinwohnerstamm praktiziert werden würde, denn es gibt dort einfach zu viel Platz und nicht genug Menschen, als dass man jemals auf die Idee kommen würde, dass man von dieser Praxis profitieren könnte. Es handelt sich um eine Reaktion auf unsere überfüllte Umwelt.
Tobias Staab: Wie verhält es sich mit der militärischen Konnotation?
Richard Siegal: Das ist nur ein Aspekt, den man mit diesem Potenzial umsetzen kann – dass Menschen in der Lage sein müssen, sich in Menschenmengen zu organisieren. Das kann sehr effektiv genutzt werden, um Krieg zu führen. Ich denke, die Römer*innen waren wahrscheinlich die ersten oder vielleicht die fortschrittlichsten, die diese Idee des kollektiven Handelns in der Kriegsführung nutzten. Aber es ist nicht nur das. Es ist auch ein ästhetisches Phänomen, und es ist wirklich wundervoll, dem zuzusehen. »Shuudan Koudou« beinhaltet eine Schönheit und trägt eine positive Gruppenmoral in sich. Aber gleichzeitig ist auch überhaupt nichts, was so viel bedeutet wie, dass es nur für sich selbst existiert, als etwas, das keine Konnotation hat.
Tobias Staab: Worin besteht die Dimension der Moral, von der Du sprichst?
Richard Siegal: Das Gefühl des Wohlbefindens, das ein Individuum über sich selbst innerhalb eines Zusammenseins haben kann. Das entsteht dabei. Es ist so ähnlich wie beim gemeinsamen Singen oder Trommeln. Man bringt die Körper zusammen, extrem synchronisiert, und dann kommen alle zusammen. Das schafft Harmonie.
Tobias Staab: Vielleicht liegt es an der deutschen Geschichte und dem sozialen Kontext, in dem ich aufgewachsen bin... aber für mich scheint der militärische Aspekt dominanter zu sein als nur eine mögliche Assoziation unter anderen. Ich kann nicht aufhören, über die Gefahren nachzudenken, die in dem, was Du als Moral bezeichnest, impliziert sind. Ich meine die Vorstellung, dass man seine eigene Individualität aufgibt, um mit einer Gruppe eins zu werden und dadurch sein kritisches Potenzial zu verlieren …
Richard Siegal: Du sagst, dass es vielleicht daran liegt, dass Du Deutscher bist?
Tobias Staab: Ja, ich hatte von klein auf eine Skepsis gegenüber all diesen Formen des Miteinanders...
Richard Siegal: Aber das ändert sich doch, oder? Die deutsche Regierung steckt derzeit Milliarden von Dollar in den Verteidigungshaushalt, und ich denke, dass sich die Einstellung der Menschen zum militärischen Verhalten, zur Verteidigung und zum Patriotismus in Deutschland in den kommenden Generationen definitiv ändern wird... Auch in Japan. Die Menschen dort werden sehr stark zum Pazifismus erzogen, auch wenn die Gesellschaft dort viel stärker formalisiert zu sein scheint, als in Deutschland. Wenngleich die Menschen in Deutschland sich wirklich viel kollektiver verhalten, als in anderen Ländern.
Tobias Staab: Ist das so?
Richard Siegal: Ja, sicher. Als ich 1997 zum ersten Mal nach Frankfurt zog, war ich schockiert, dass mich die Leute zurechtwiesen, wenn ich die Regeln brach. Wenn ich zum Beispiel bei Rot über die Ampel ging, selbst wenn keine Autos da waren. Oder dass die U-Bahnen hier auf Ehrlichkeit basieren – man wird kaum kontrolliert, während es in anderen Gesellschaften wie New York, wo ich herkam, riesige Schranken gibt, so dass es sehr schwierig wird, in die U-Bahn zu kommen, ohne zu bezahlen. Ich denke, dass diese Dinge sehr bezeichnend für einen allgemeinen Zusammenhalt in der Gesellschaft sind.
Tobias Staab: Eine der Fragen, die wir uns auf unserer Forschungsreise nach Japan stellten, war die nach den Unterschieden zwischen Gesellschaften, die individuell strukturiert sind, und Gesellschaften, die auf einem eher kollektiven Denken aufbauen...
Richard Siegal: Ja, es geht um eine Kollision zwischen den hyperindividualistischen Gesellschaften Westeuropas und Nordamerikas, die mit dieser anderen, ultraautoritären Art des Zusammenlebens koexistieren müssen.
Tobias Staab: Was kannst Du über den Titel BALLET OF (DIS)OBEDIENCE sagen – was ist ein Ballett des Ungehorsams?
Richard Siegal: Der ursprüngliche Titel war »Ballet of Obedience«, aber dann wurde es umbenannt in BALLET OF (DIS)OBEDIENCE. Ich hätte auch gerne einen zweiten Titel oder Untertitel, der lautet: »Theater of No«.
Tobias Staab: Worauf bezieht sich das?
Richard Siegal: Auf das japanische »Noh-Theater«, vor allem im Kontext eines Stück von Yukio Mishima, das wir ursprünglich geplant hatten, zu verwenden. Und natürlich auf den Ungehorsam.
Tobias Staab: Verwendest Du auch formale Aspekte des »Noh-Theaters«?
Richard Siegal: Ich habe es wirklich genossen, das »Noh-Theater« in Tokio zu sehen. Aber was ist »Noh-Theater«? Es ist die Form des Textes der Stücke, die immer der gleichen Formel folgen, indem sie von der Realität des Stückes in eine Art Traumsequenz fallen. Im »Noh-Theater« sind die Bühne im Raum und das Spiel extrem formalisiert. In unserem Fall gibt es bestenfalls eine Abstraktion davon. Meine Bühne ist eher vom Boden der Turnhalle inspiriert, an der Sportuniversität in Yokohama, wo wir »Shuudan Koudou« zusammen mit den japanischen Student*innen geprobt haben. Der Holzboden dort ist überzogen von aufgemalten Linien für die sportlichen Aktivitäten, die dort stattfanden. Die Lackschichten sind seit den 70er Jahren am abblättern. Das war zudem ein extrem resonanzfähiger Raum, so dass die Schritte der Schüler und ihre Stimmen im Raum sehr lange nachhallten. Dadurch entstand dieses bassige Dröhnen der Schritte beim Marschieren. In den mittleren Frequenzen waren Stimmen die hören und im oberen Frequenzbereich gab es diese Quietschgeräusche, die herauskommen, wenn die Gruppe um die Ecke biegt. Dabei entstand eine wunderbare Musik. Ich hoffe diese Elemente werden auch im Stück zu hören sein.
Tobias Staab: Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der Pina-Bausch-Tänzerin Nazareth Panadero?
Richard Siegal: Bettina Wagner-Bergelt hatte mich 2018 gebeten, ein Projekt mit den Tänzer*innen der Pina Bausch Company zu machen. Und ich habe mich für eine Gruppe von älteren Tänzer*innen entschieden, die mit Pina Bausch zusammengearbeitet hatten. Nazareth war eine von ihnen. Sie kamen nach Madrid und wir arbeiteten etwa eine Woche lang zusammen, um dann nach Wuppertal zu gehen und dort einige Tage zu verbringen. Wir haben uns wirklich gut verstanden, aber dann kam die Pandemie. Das Material, das wir in diesen zwei Wochen gemacht hatten, wurde auf Eis gelegt und wir wussten nicht, was wir damit machen sollten. Nazareth hatte dabei wirklich interessantes Bewegungsmaterial produziert und mir Videos davon geschickt. Noch vor dem Lockdowns hatten wir einige Szenen entwickelt.
Tobias Staab: Habt Ihr auch mit Text gearbeitet?
Richard Siegal: Ja, mit Sprache, mit Texten. Es gab sogar einen Song. Alles hatte mit dem Trauerprozess zu tun, mit den verschiedenen emotionalen Stadien, die man durchläuft. Das rührte von meinem Interesse her, an Pinas Tod einerseits und andererseits an dem Zustand, in dem ich die Kompanie vorfand. Es war offensichtlich, dass es in den letzten zehn Jahren nach ihrem Tod eine Menge Aufruhr gab. Es herrschte große Verwirrung, Wut und Frustration. Ein angemessener Trauerprozess war nie gemeinsam durchlaufen worden. Es ging also um den Tod. Dann wollte ich, dass sie in ECTOPIA mitspielen sollte, aber es stellte sich leider heraus, dass sie einen Terminkonflikt hatte. Schließlich habe ich Nazareth für dieses Projekt gefragt, ob sie die Rolle übernehmen wollte, und sie willigte ein – obwohl sie keine Schauspielerin sei, es zu versuchen.
Tobias Staab: Kannst Du bitte etwas über die Texte erzählen, die in BALLET OF (DIS)OBEDIENCE vorkommen, und wie sie mit der Praxis von »Shuudan Koudou« zusammenhängen?
Richard Siegal: Wir begannen eigentlich mit einem Text von Yukio Mishima aus einer Sammlung von Stücken mit dem Titel FIVE MODERN NOH PLAYS. Wir haben das erste Stück, SOTOBA KOMACHI, verwendet. Diesen Text habe ich größtenteils in einen Monolog für Nazareth umgeschrieben, aber im Stück selbst ist es ein Dialog mit einem Dichter. Die Rolle des Dichters wurde implizit zu der des Publikums, an das sie sich wendet. Es gab auch eine lange Passage, in der die Tänzer*innen Rollen von verschiedenen Figuren übernahmen. Das war eine Traumsequenz, in der es eine Art Besessenheit, eine Übertragung, gab, die von den Tänzer*innen dargestellt werden sollte. Der Text ist insofern sehr interessant, als er der Form des alten »Nōh-Theaters« folgt.
Mishimas Text spiegelt nach meinem Verständnis bestimmte Themen über die Verwestlichung oder die Kontamination der – in Anführungszeichen – »reinen japanischen Kultur« wider. Der Text ist also ein Ausdruck von Mishimas Anliegen als Künstler, als Bürger, als Nationalist, eine verlorene nationale Identität zu bewahren. Aber das ist natürlich nicht alles in diesem Stück. Es gibt dort auch sehr starke Themen wie Tod und Verfall, Schönheit und Hässlichkeit... All diese Dinge wurden in Beziehung zum »Shuudan Koudou« gesetzt. Dabei entstanden Muster und Assoziationen zu militärischem Verhalten, nationaler Identität, bestimmten Arten anorganischer Organisation, Geometrie... die Beziehung zwischen diesen Elementen war sehr komplex.
Aber da wir die Rechte an diesem Text nicht bekommen haben, sind wir auf einen Text von Franz Kafka ausgewichen –EIN BERICHT AN EINE AKADEMIE. Es handelt sich um den Monolog eines Affen in Gefangenschaft, der an der Goldküste Afrikas gefangen genommen und in einem Transportkäfig nach Europa gebracht wurde. Um aus seiner Gefangenschaft zu entkommen lernt der Affe, das Verhalten jener Menschen nachzuahmen, die ihn gefangen genommen haben. Er wird zu einem eifrigen Schüler und lernt, Hände zu schütteln, zu rauchen, zu trinken und zu sprechen. Er ahmt die Menschen so gut nach, dass er immer mehr zu einem Mitglied der Gesellschaft wird. Ein gefeierter Bürger, der seine Geschichte einem internationalen Publikum erzählt. Die Beziehung zwischen diesem Text und dem »Shuudan Koudou«verändert naturgemäß die Bedeutung des »Shuudan Koudou« gegenüber dem Mishima-Text. Da der Kafka-Text so viel mehr und auf direktere Weise mit Sozialisation zu tun hat, überschneidet er sich in gewisser Weise weniger schräg mit dem Thema, das der »Shuudan Koudou« anspricht.
Tobias Staab: Worin liegen dabei die Herausforderungen für die Tänzer*innen?
Richard Siegal: Nun, die Tänzer*innen sind keine ausgebildeten Schauspieler*innen. Sie sind sich der Techniken und Konventionen des Schauspiels nicht bewusst und das stellt also eine Herausforderung für sie dar. Man erhält dabei eine Form des Spiels, die sich kategorisch vom Schauspiel unterscheidet. Wenn jemand wie Martina Chavez oder Nico Martínez auf der Bühne mit einer sehr natürlichen Präsenz spricht und ein Gefühl für Timing, Musikalität und Authentizität hat, hat das etwas Würdiges und Betörendes. Solange wir uns bewusst sind, dass wir nicht versuchen, wirklich in die Geschichte des Sprechtheaters einzutreten, können wir zuversichtlich sein, dass wir etwas zu sagen haben.
Tobias Staab: Warum ist es Dir überhaupt wichtig, mit einem Narrativ zu arbeiten?
Richard Siegal: Ich denke, es ist ein guter Moment für die Company, sich einer Erzählung im konventionelleren Sinne von Storytelling oder Charakterentwicklung zu widmen, denn das haben wir in all den Jahren nicht wirklich getan, obwohl wir dies gewissermaßen zu unserer Mission erklärt hatten: Neue Erzählungen zu schaffen, die mehr mit der Zeit, in der wir leben, übereinstimmen.
Bei unserem Debütabend im Jahr 2017 hieß eines der Stücke EXCERPTS OF A FUTURE BALLET IN THE SUBJECT OF CHELSEA MANNING. Ich hatte also bereits das Fundament gelegt, auf dem wir ein abendfüllendes Handlungsballett machen könnten, das die Geschichte von Chelsea Manning erzählt – was wir aber noch nicht getan haben.
Aber der Katalysator für diesen Kurswechsel war sicherlich die Einladung von Hein Mulders, Intendant der Oper Köln, in dieser Spielzeit eine PETRUSCHKA zu machen, durch die ich aufs Neue mit der Idee einer Erzählung konfrontiert wurde. Für uns geht es nicht unbedingt darum, neue Erzählungen zu schaffen, sondern auch darum, bestehende Narrative neu zu erzählen. Das kann sogar ein bereits existierendes Stück Literatur oder ein Handlungsballett sein, vorausgesetzt, wir vermeiden dabei, überholte Werte und Moralvorstellungen in unsere Gegenwart und Zukunft zu schleppen. Es ist wichtig, die Relevanz dieser Geschichten zu bewahren. Ich denke, es ist auch generell eine gute Zeit, um Narrativen den Weg zurück in den zeitgenössischen Tanz zu ebnen. Es gibt schließlich einige Dinge, die nicht durch Abstraktion gesagt werden können – so wie es einige Dinge gibt, die nicht durch eine Erzählung vermittelt werden können. Dabei geht es vor allem um Geschichten, die auf der Bühne erzählt werden können, und die im Moment besonders wichtig zu hören sind. Geschichten über Nationalismus. Geschichten über die Natur des Todes und des Sterbens und des Verfalls, oder auch Geschichten über Kontrolle und Machtstrukturen, wie sie vielleicht in PETRUSCHKA thematisiert wurden.
Tim Etchells:
Of And From
(On Freedom) 2017

Jens Balzer: Ethik der Appropriation
Appropriation ist ein umkämpfter Begriff, geradezu ein begrifflicher Knotenpunkt der kulturellen Kämpfe in unserer Gegenwart. Wer kulturelle Aneignung, »cultural appropriation«, betreibt, der macht sich – einem vielerorts verbreiteten Verständnis zufolge – eines Vergehens schuldig: Angehörige einer herrschenden Kultur beuten Erzeugnisse marginalisierter Kulturen aus, um sich damit zu schmücken, ohne den Erzeugern und Erzeugerinnen den nötigen Respekt zu erweisen. Gegen diese Kultur der raubenden Aneignung hat sich breiter Protest erhoben. Er zielt darauf, Appropriation zu ächten und zu verbieten. Der Impuls, der hinter diesem Protest steht, ist (…) leicht nachzuvollziehen. Es ist intuitiv richtig, dass Weiße sich nicht mit »blackfacing« als Schwarze kostümieren sollen, ebenso wie es unmittelbar einsichtig ist, dass sich in der weißen Ausbeutung schwarzer Musik – seit Al Jolson und Elvis – ungerechte Machtverhältnisse spiegeln und zementieren. Ebenso nachvollziehbar ist indes das intuitive Unbehagen daran, kulturelle Aneignung generell zu ächten. Denn es schlechterdings keine Kultur denkbar, die nicht aus der Aneignung vergangener Formen ergibt. Wer Appropriation prinzipiell zu einem Vergehen erklärt, das es zu verbieten gilt, raubt letztlich der Kultur jede Beweglichkeit und jedes Leben.
Die Frage, die sich daraus ergibt, ist mithin: Wie kann man zu einer Kritik falscher Formen der Appropriation kommen, die gleichwohl nicht das Verfahren als solches infrage stellt, sondern dieses im Gegenteil als Motor jeder kulturellen Entwicklung anerkennt und feiert? Wie kommt man zu einer Ethik der Appropriation, die richtige und falsche Formen voneinander unterscheidet und aneinander begrifflich schärft?
[...]
Es gibt kein Außerhalb der Macht, so hieß es einst bei Michel Foucault. Es gibt kein Außerhalb der Appropriation – so könnte man anschließend daran formulieren; es ist sogar so, dass jede emanzipatorische Form der Kultur notwendig eine diverse, also appropriierende ist. Eine Ethik der Appropriation müsste sich also nicht in der Form des Verbots konstituieren, sondern viel mehr in der Form des Gebots: Appropriiere! Aber tue es richtig! Das heißt: Tue es, indem du appropriierst -– und darin zugleich die Machtverhältnisse reflektierst, die sich in der Appropriation spiegeln. Der Kritik fällt dann die Aufgabe zu, misslungene von gelungenen Formen der Appropriation zu unterscheiden – und misslungene von gelungenen Formen der Kritik der Appropriation. Ich habe versucht, Vorschläge für diese Unterscheidung zu machen. Misslungene Formen der Appropriation sind ihr gemäß solche, in denen – vermeintliche – Authentizität oder gar fremde Traumata und Unterdrücktheit konsumiert werden. Misslungene Formen der Kritik der Appropriation sind solche, in denen für eine bestimmte Kultur eine unangreifbare Form der Authentizität beschworen wird - sei es für die »eigene« Kultur, die es gegen den Diebstahl von »anderen« zu verteidigen gilt; sei es für eine »andere« Kultur, deren vermeintliche Authentizität zur Bereicherung des »eigenen« Lebens appropriiert wird.
Gelungene Formen der Appropriation sind hingegen solche, in denen aus unterschiedlichen Einflüssen etwas Neues entsteht – etwas Neues, indem die Elemente sichtbar und reflektiert bleiben, aus denen ein Kunstwerk, ein kulturelles Motiv, eine Selbstinszenierung zusammengesetzt sind. Gelungene Formen der Kritik der Appropriation sind gerade solche, in denen nicht im bloßen Modus des Verbots operiert wird, sondern in denen man auf ausbeutende Appropriationen mit »counter appropriations« reagiert: Mit der Wiederaneignung von enteigneten Motiven und Mustern zum Zweck einer Fortschreibung der »eigenen« Tradition, in der diese aber gleichsam als zusammengesetzte, in sich bewegte, unauthentische kenntlich bleibt.
Nur in dieser kritischen Praxis der Gegenappropriation kann man auch zu einem Verständnis der Machtverhältnisse kommen, die die Kultur und die Kulturen durchziehen. Diese äußern sich nicht nur in Formen der Ausbeutung einer Kultur durch eine andere, sondern vielmehr auch darin, dass jede Art des entfesselten Spiels der Diversität eingehegt wird durch das Ziehen von Grenzen, die einerseits immer wieder neue, scheinhafte Entfesselungen ermöglichen, mit denen sich der Profit an kulturellen Provokationen aufrecht erhalten und steigern lässt – und an denen entlang andererseits unaufhörlich um Anerkennung gekämpft werden soll. Divide et impera; In ihrer unreflektierten (Verbots-)Variante ist die Kritik der Appropriation der hegemonialen neoliberalen Fragmentierung und Entsolidarisierung näher, als sie es sich eingestehen will. Dagegen wäre eine Ethik des Appropriierens zu setzen, die um die Ursprungslosigkeit aller kulturellen Selbst-Verhältnisse weiß, eine Ethik, die das Fremde im Eigenen freudig umarmt – und der die Solidarität im Diversen wichtiger ist, als der Kampf aller gegen alle.
Die Frage, die sich daraus ergibt, ist mithin: Wie kann man zu einer Kritik falscher Formen der Appropriation kommen, die gleichwohl nicht das Verfahren als solches infrage stellt, sondern dieses im Gegenteil als Motor jeder kulturellen Entwicklung anerkennt und feiert? Wie kommt man zu einer Ethik der Appropriation, die richtige und falsche Formen voneinander unterscheidet und aneinander begrifflich schärft?
[...]
Es gibt kein Außerhalb der Macht, so hieß es einst bei Michel Foucault. Es gibt kein Außerhalb der Appropriation – so könnte man anschließend daran formulieren; es ist sogar so, dass jede emanzipatorische Form der Kultur notwendig eine diverse, also appropriierende ist. Eine Ethik der Appropriation müsste sich also nicht in der Form des Verbots konstituieren, sondern viel mehr in der Form des Gebots: Appropriiere! Aber tue es richtig! Das heißt: Tue es, indem du appropriierst -– und darin zugleich die Machtverhältnisse reflektierst, die sich in der Appropriation spiegeln. Der Kritik fällt dann die Aufgabe zu, misslungene von gelungenen Formen der Appropriation zu unterscheiden – und misslungene von gelungenen Formen der Kritik der Appropriation. Ich habe versucht, Vorschläge für diese Unterscheidung zu machen. Misslungene Formen der Appropriation sind ihr gemäß solche, in denen – vermeintliche – Authentizität oder gar fremde Traumata und Unterdrücktheit konsumiert werden. Misslungene Formen der Kritik der Appropriation sind solche, in denen für eine bestimmte Kultur eine unangreifbare Form der Authentizität beschworen wird - sei es für die »eigene« Kultur, die es gegen den Diebstahl von »anderen« zu verteidigen gilt; sei es für eine »andere« Kultur, deren vermeintliche Authentizität zur Bereicherung des »eigenen« Lebens appropriiert wird.
Gelungene Formen der Appropriation sind hingegen solche, in denen aus unterschiedlichen Einflüssen etwas Neues entsteht – etwas Neues, indem die Elemente sichtbar und reflektiert bleiben, aus denen ein Kunstwerk, ein kulturelles Motiv, eine Selbstinszenierung zusammengesetzt sind. Gelungene Formen der Kritik der Appropriation sind gerade solche, in denen nicht im bloßen Modus des Verbots operiert wird, sondern in denen man auf ausbeutende Appropriationen mit »counter appropriations« reagiert: Mit der Wiederaneignung von enteigneten Motiven und Mustern zum Zweck einer Fortschreibung der »eigenen« Tradition, in der diese aber gleichsam als zusammengesetzte, in sich bewegte, unauthentische kenntlich bleibt.
Nur in dieser kritischen Praxis der Gegenappropriation kann man auch zu einem Verständnis der Machtverhältnisse kommen, die die Kultur und die Kulturen durchziehen. Diese äußern sich nicht nur in Formen der Ausbeutung einer Kultur durch eine andere, sondern vielmehr auch darin, dass jede Art des entfesselten Spiels der Diversität eingehegt wird durch das Ziehen von Grenzen, die einerseits immer wieder neue, scheinhafte Entfesselungen ermöglichen, mit denen sich der Profit an kulturellen Provokationen aufrecht erhalten und steigern lässt – und an denen entlang andererseits unaufhörlich um Anerkennung gekämpft werden soll. Divide et impera; In ihrer unreflektierten (Verbots-)Variante ist die Kritik der Appropriation der hegemonialen neoliberalen Fragmentierung und Entsolidarisierung näher, als sie es sich eingestehen will. Dagegen wäre eine Ethik des Appropriierens zu setzen, die um die Ursprungslosigkeit aller kulturellen Selbst-Verhältnisse weiß, eine Ethik, die das Fremde im Eigenen freudig umarmt – und der die Solidarität im Diversen wichtiger ist, als der Kampf aller gegen alle.
Alva Noto: Musik für
»BALLET OF (DIS)OBEDIENCE«

Dieter Wuschanski
Alva Noto: »noh talk«
Alva Noto: »broken conversation«
Alva Noto: »obsessive relation«
Nachweise
Redaktion, Texte und Videos: Tobias Staab
LITERATURNACHWEISE:
Tobias Staab und Karin Honda: »SHUUDAN KOUDOU« Glossar, Köln März 2023.
Tobias Staab: »30 % Unsicherheit, 70 % Vertrauen. Auszüge eines Berichtes über eine Begegnung«, Tokio September 2022.
Franz Kafka: Bericht an eine Akademie, in ders.: »Die Erzählungen. Originalfassung«. Herausgegeben von Roger Hermes, Frankfurt/Main 1997 (Fassung: Tobias Staab und Richard Siegal).
Tim Etchells: »Of And From (On Freedom)«, 2017.
Tobias Staab: »Das Potenzial, sich in Menschenmengen zu organisieren
Der Choreograf Richard Siegal im Gespräch mit dem Dramaturgen Tobias Staab«, Beitrag zum Programmheft, Köln März 2022.
Jens Balzer: »Ethik der Appropriation«, Berlin 2022.
MUSIKNACHWEISE
Musik: Alva Noto
© N-033 NOTON. Archiv für Ton und Nichtton / Edition Carsten Nicolai / Budde Music Publishing
PROBENFOTOS:
Thomas Schermer
Richard Siegal / Ballet of Difference dankt besonders: Keiko Kodaka, Peter Anders, Manfred Stoffel, Jörg Friebl, Emmy Jenrod, Alexander Bohlander, Mr. Omi, Mr. Yaguchi, Kazuma Glen Motomura sowie dem »BOD Friends Circle«.
LITERATURNACHWEISE:
Tobias Staab und Karin Honda: »SHUUDAN KOUDOU« Glossar, Köln März 2023.
Tobias Staab: »30 % Unsicherheit, 70 % Vertrauen. Auszüge eines Berichtes über eine Begegnung«, Tokio September 2022.
Franz Kafka: Bericht an eine Akademie, in ders.: »Die Erzählungen. Originalfassung«. Herausgegeben von Roger Hermes, Frankfurt/Main 1997 (Fassung: Tobias Staab und Richard Siegal).
Tim Etchells: »Of And From (On Freedom)«, 2017.
Tobias Staab: »Das Potenzial, sich in Menschenmengen zu organisieren
Der Choreograf Richard Siegal im Gespräch mit dem Dramaturgen Tobias Staab«, Beitrag zum Programmheft, Köln März 2022.
Jens Balzer: »Ethik der Appropriation«, Berlin 2022.
MUSIKNACHWEISE
Musik: Alva Noto
© N-033 NOTON. Archiv für Ton und Nichtton / Edition Carsten Nicolai / Budde Music Publishing
PROBENFOTOS:
Thomas Schermer
Richard Siegal / Ballet of Difference dankt besonders: Keiko Kodaka, Peter Anders, Manfred Stoffel, Jörg Friebl, Emmy Jenrod, Alexander Bohlander, Mr. Omi, Mr. Yaguchi, Kazuma Glen Motomura sowie dem »BOD Friends Circle«.
EINE PRODUKTION VON SCHAUSPIEL KÖLN UND TANZ KÖLN
Unterstützer*innen
